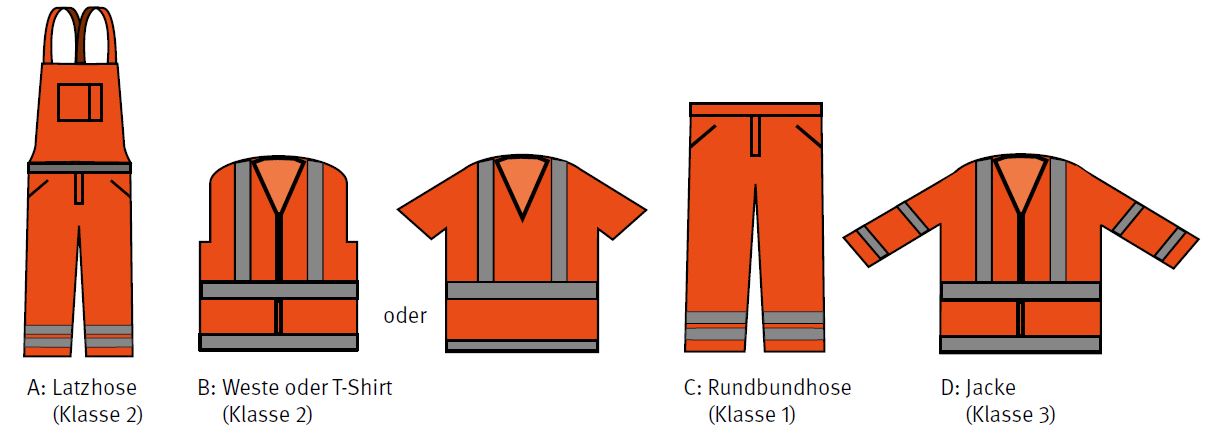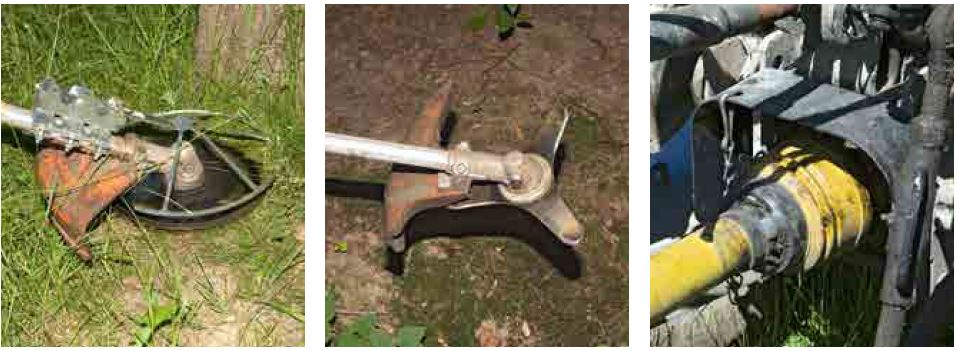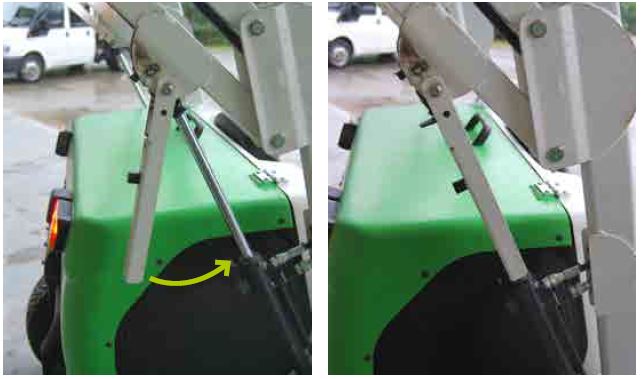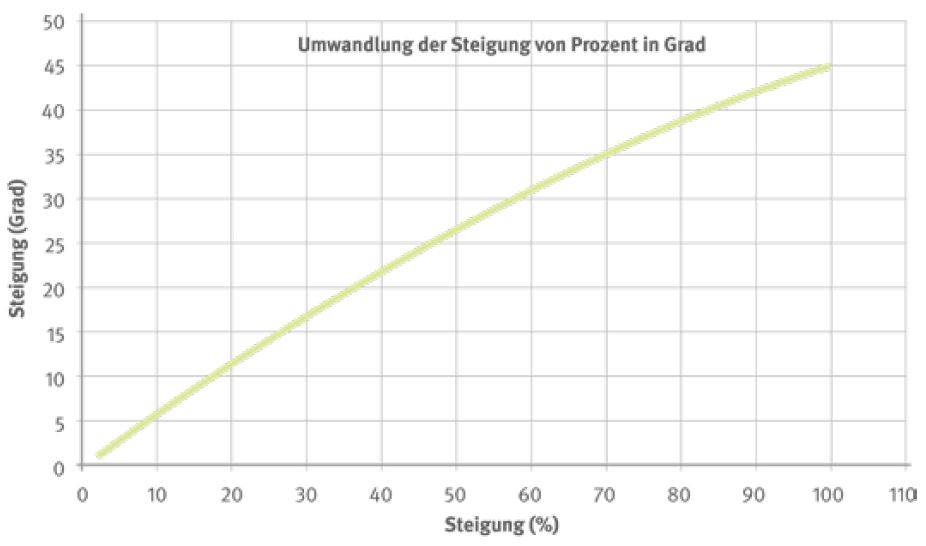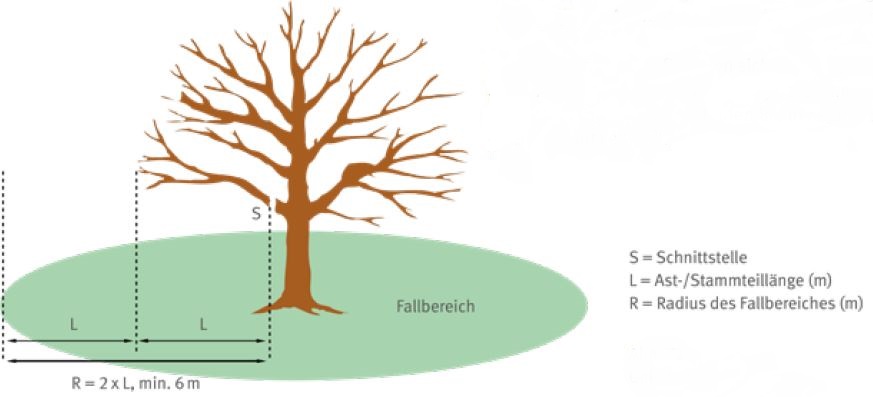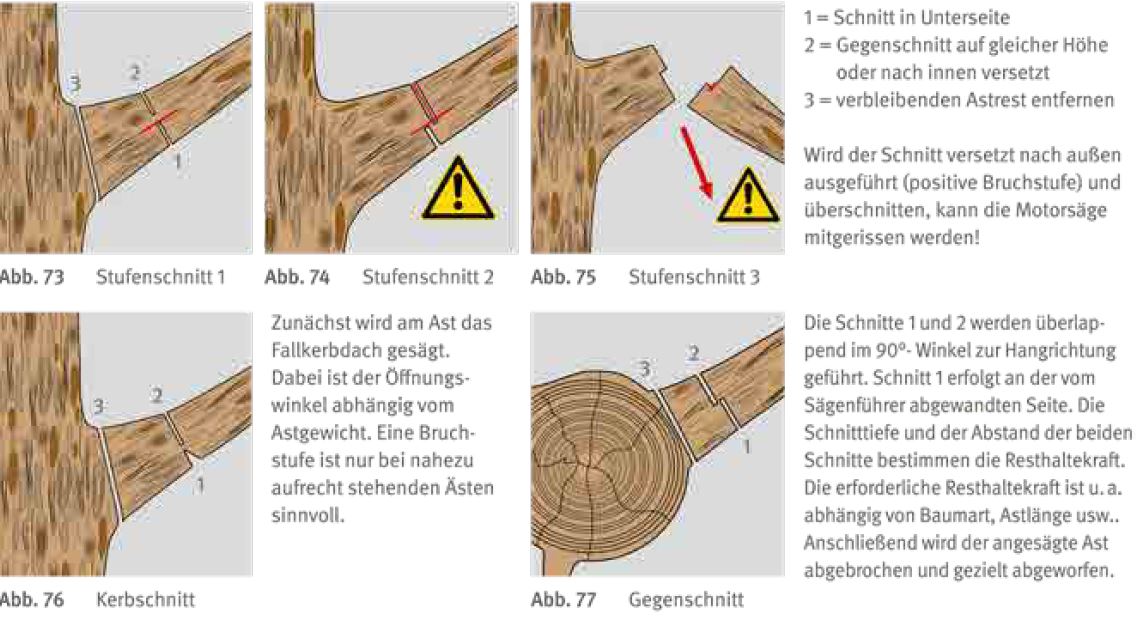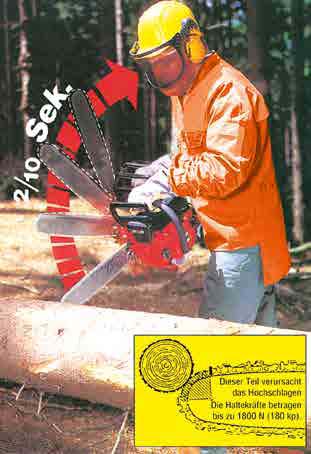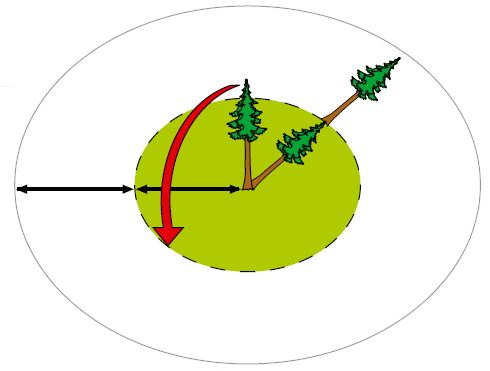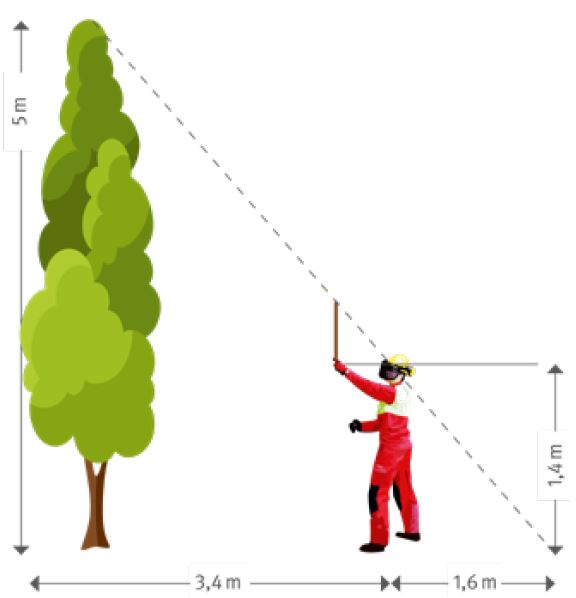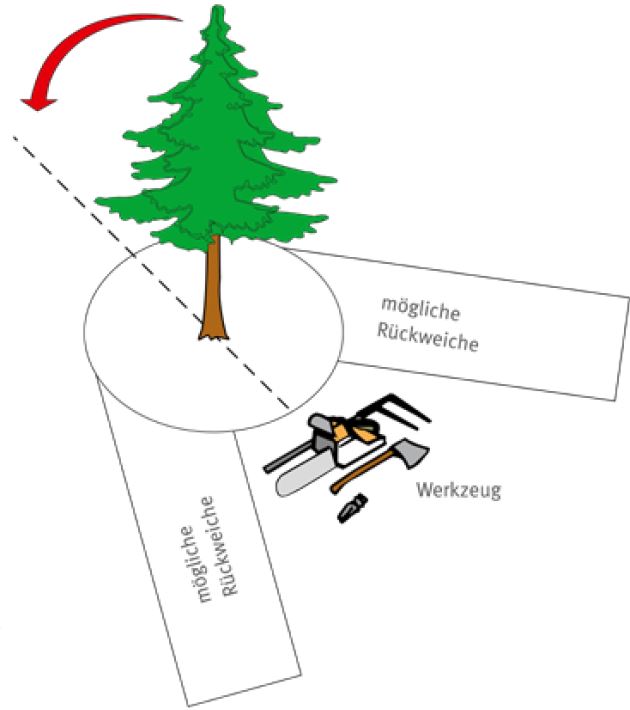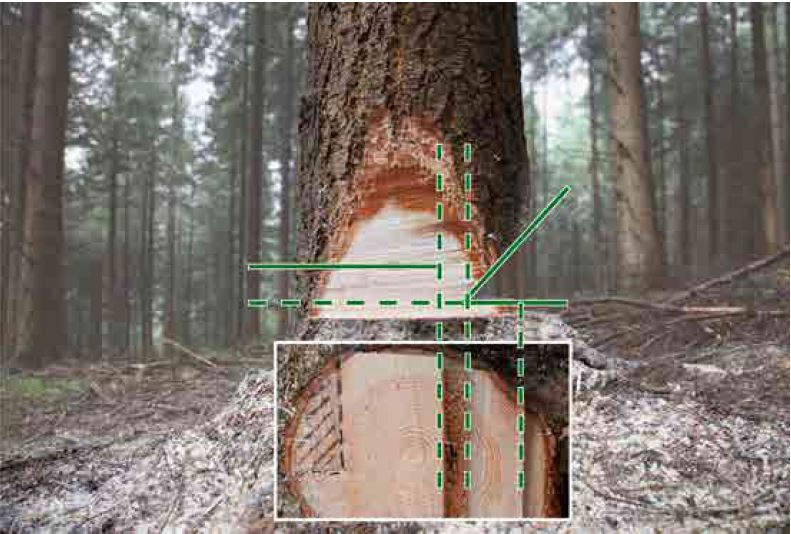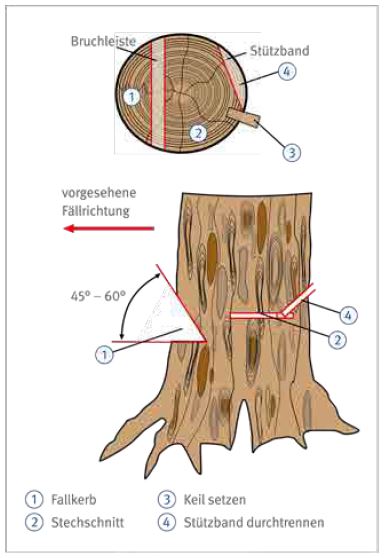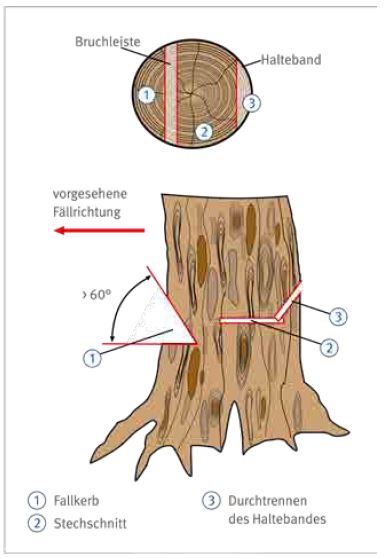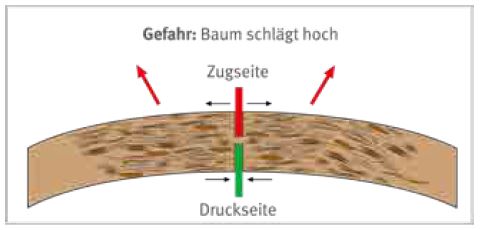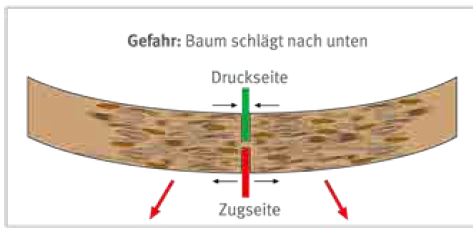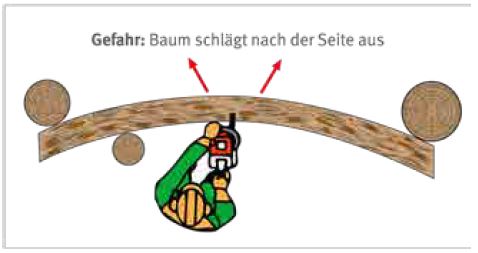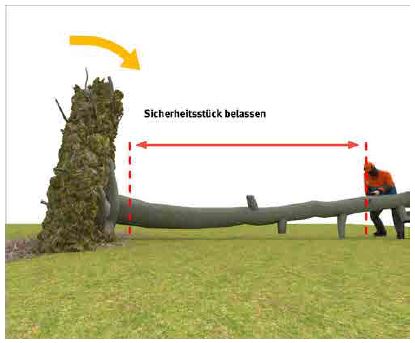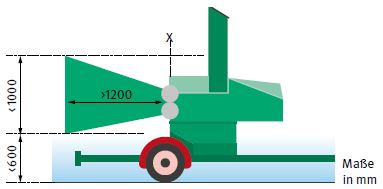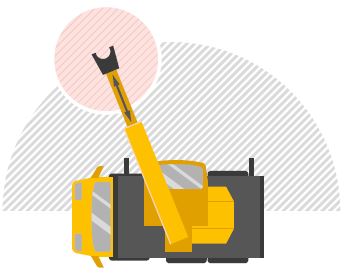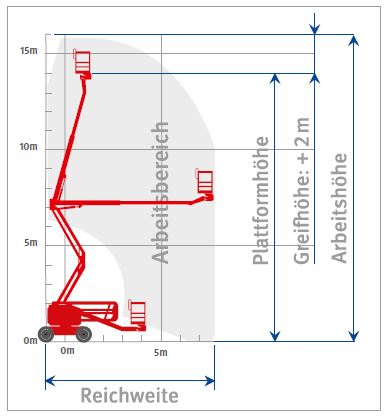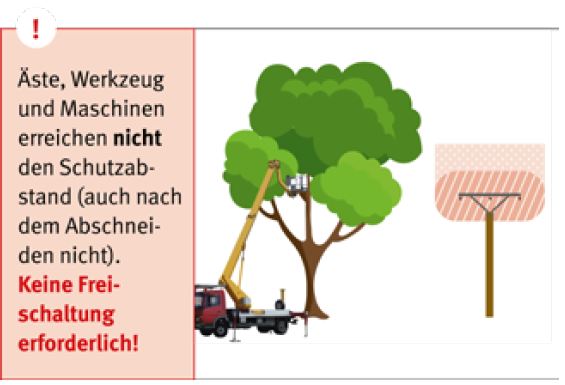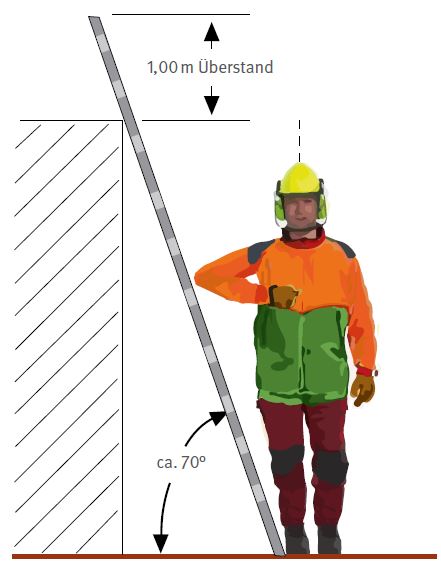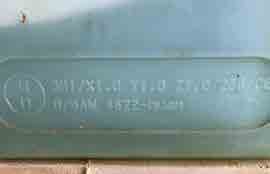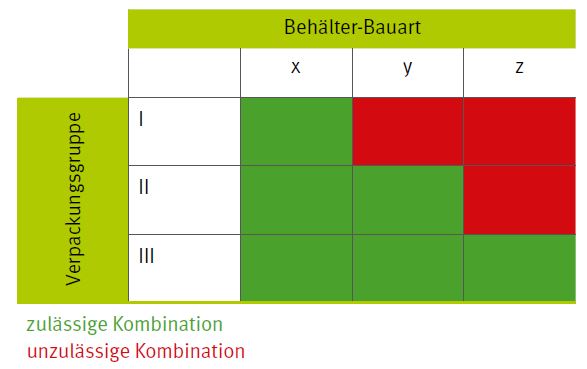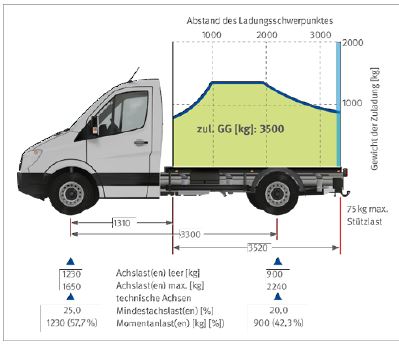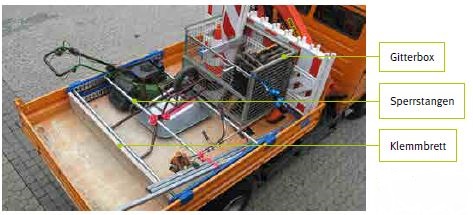3 Arbeitsplätze und Tätigkeiten:
Gefahren und Maßnahmen
3.1 Arbeiten im Freien
Grün- und Landschaftspflegearbeiten finden hauptsächlich im Freien statt.
Nässe, Kälte, Wind, UV-Strahlung: Die Beschäftigten sind unmittelbar dem
Wettergeschehen ausgesetzt. Durch eingeschränkte Sicht, Glätte, plötzlich auftretende
Unwetter usw. können sich gefährliche Situationen ergeben. Auch durch
die Topographie können Gefährdungen entstehen. Sturz- und Stolperunfälle
stehen an der Spitze des Unfallgeschehens. Bitte beachten Sie: Auch im Freien
müssen sanitäre Einrichtungen im Nahbereich vorhanden sein und die Möglichkeit
bestehen, Pausen witterungsgeschützt verbringen zu können.


|
Gefährdungen
|
|
Bei Tätigkeiten im Freien treten häufig folgende Gefährdungen auf:
|
|
Maßnahmen
|
|
Stellen Sie sicher, dass bei Arbeiten im Freien, abhängig von der Gefährdungsbeurteilung, gegen diese und weitere mögliche Gefährdungen folgende Maßnahmen getroffen werden:
Maßnahmen zum Schutz vor UV-Strahlung können sein:
Maßnahmen bei erhöhten Ozonwerten
- Verlagern von schwerer körperlicher Arbeit in die Morgen- und Vormittagsstunden
- Zwischenschaltung leichterer Arbeiten
- Verlagern der Arbeiten in den Schatten
- Vermeiden von Mehrfachbelastungen durch andere Reizstoffe wie Umweltbelastungen und Gefahrstoffe
- Einlegen von Erholungspausen
- Pausen in geschlossenen Räumen oder im Schatten verbringen
Maßnahmen bei Hitze
Maßnahmen gegen Kälte
- Bereitstellung und Verwendung geeigneter Wetterschutzkleidung
- Beheizbare Pausenräume (z. B. Bauwagen oder KFZ mit Standheizung)
Maßnahmen bei witterungsbedingten Sichtbehinderungen
- Arbeiten, bei denen der Gefahrenbereich nicht mehr überblickt werden kann, einstellen (z. B. Baumarbeiten, Freischneiderarbeiten)
Maßnahmen bei Unwettern
- Arbeit einstellen und gegebenenfalls Schutz in Gebäuden oder Fahrzeugen suchen
Maßnahmen gegen Stolper-, Rutsch- und Sturzunfälle
- Tragen von Schutzschuhen, mindestens mit Knöchelschutz und profilierter Sohle
 Persönliche Schutzausrüstungen Persönliche Schutzausrüstungen
Wetterschutzkleidung
Diese Schutzkleidung schützt den Träger gegen die Einwirkungen von Nässe, Wind und Umgebungskälte bis -5 °C. Die Kleidung muss so ausgeführt sein, dass sie den Thermoregulationsprozess des menschlichen Körpers unterstützt. Dazu gehört eine möglichst hohe Wasserdampfdurchlässigkeit bei gleichzeitiger Winddichtheit.
 Beurteilung der Arbeitsbedingungen und Dokumentation (Gefährdungsbeurteilung) Beurteilung der Arbeitsbedingungen und Dokumentation (Gefährdungsbeurteilung)
Bitte berücksichtigen Sie in der Gefährdungsbeurteilung auch die speziellen Gefährdungen durch Tätigkeiten im Freien!
| Zur Gewährleistung persönlicher Hygienemaßnahmen sind in unmittelbarer Nähe der Arbeitsstätte/des Arbeitsplatzes Sanitäreinrichtungen (Toiletten sowie Waschgelegenheiten mit möglichst fließendem Wasser sowie den hygienisch erforderlichen Reinigungs- und Pflegemitteln) bereitzustellen. Nach Absprache können in der Nähe befindliche öffentliche Einrichtungen mit ihren Sanitäranlagen, wie in Schulen oder Verwaltungsgebäuden vorhanden, genutzt werden (vgl. Arbeitsstättenverordnung, § 6 Abs. 2).
| 
Abb. 6 Mindeststandard: Sauberes Wasser zum Händewaschen |
|
Weitere Informationen
|
|
In Deutschland sind ca. 2,5 Millionen Beschäftigte überwiegend oder teilweise im Freien tätig. Im Vergleich zur Allgemeinbevölkerung müssen sich Beschäftigte bestimmter Branchen jedoch berufsbedingt häufig im Freien aufhalten und sind somit der Sonnenstrahlung intensiver ausgesetzt.
- DGUV Information 203-085 "Arbeiten unter der Sonne"
- SVLFG B32 "Sonnenschutz"
|
|
3.2 Arbeiten mit biologischer Gefährdung
Bei der Grün- und Landschaftspflege werden die Arbeiten überwiegend auf bewachsenen Flächen durchgeführt, die den verschiedensten Pflanzen und Tieren als Lebensraum dienen. Daraus können sich komplexe biologische Gefährdungen ergeben, die für einen wirksamen Schutz eine Vielzahl von geeigneten Maßnahmen erfordern. Neben der Beachtung hygienischer Grundregeln, der regelmäßigen Durchführung arbeitsmedizinischer Vorsorge und dem Tragen geeigneter persönlicher Schutzausrüstung spielt die umfassende Unterweisung der Beschäftigten eine große Rolle.

|
Weitere Informationen
|
- DGUV Information 214-078 "Vorsicht Zecken!"
|
|
Gefährdungen
|
|
Durch Zecken übertragene Krankheiten
Durch Zecken übertragene Krankheiten stellen eine erhebliche
Gefährdung für die Beschäftigten dar. Die für den
Menschen in Deutschland gefährlichste Zeckenart ist der
Holzbock. In den letzten Jahren breitet sich auch die größere
Auwaldzecke aus. Zecken sind besonders zwischen
März und November aktiv. Sie lauern überwiegend in
niederer Vegetation auf ihre Opfer. Gelangen sie auf den
Körper eines Menschen, suchen sie sich eine geeignete
Einstichstelle und saugen bis zu mehreren Tagen Blut.
(s. Abb. 8) Dieser Vorgang ist schmerzfrei, weshalb Zeckenstiche
häufig nicht wahrgenommen werden. Während Zecken bundesweit mit Borrelien infiziert sein können, ist
die Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME) hauptsächlich in Süddeutschland verbreitet. (s. Abb. 9) Borreliose
ist die häufigste durch Zecken übertragene bakteriologische
Erkrankung. Die Borrelien leben im Darm der Zecke.
Eine Übertragung der Borrelien vom Zeckendarm in den
menschlichen Organismus findet erst nach einer Saugdauer
von etwa 8–12 Stunden statt. Das FSME-Virus wird
sofort nach dem Einstechen aus den Speicheldrüsen der
Zecken übertragen.
|

Abb. 8 Saugende Zecke auf der Haut

|
 Abb. 10 Wanderröte |
Abb. 9 Verbreitung FSME (nach Vorlage Robert Koch-Institut (RKI) |
|
Tetanus (Wundstarrkrampf)
Die Erreger des Wundstarrkrampfes sind in Böden weit verbreitet. Die intakte Haut verhindert das Eindringen in den Körper. Durch Hautrisse oder kleinste Verletzungen, beispielsweise durch Dornen oder Splitter, können Erreger in die Wunden gelangen. Dort können sie ein gefährliches Gift produzieren, welches tödlich sein kann.
Hanta-Virus
Hantaviren werden in Deutschland vor allem durch die Rötelmaus übertragen. Die Infektionsgefahr ist regional und von Jahr zu Jahr sehr unterschiedlich. Infizierte Nager scheiden die Viren mit ihrem Urin und Kot aus. Beispielsweise beim Reinigen von wenig genutzten Schuppen oder beim Umsetzen von Komposthaufen können diese Exkremente aufgewirbelt und dann eingeatmet werden. In Mitteleuropa verläuft die Krankheit häufig grippeähnlich mit teilweise hohem Fieber. Bei einigen Erkrankten führt die Infektion zu Nierenfunktionsstörungen bis hin zum Nierenversagen oder zu Multifunktionsstörungen.
Daneben gibt es eine Vielzahl weiterer Erreger, die aber nur in seltenen Fällen bei gärtnerischen Arbeiten zu Erkrankungen führen.
Insektenstiche
Stechende Insekten stellen eine Gefahr dar, da in der Grün- und Landschaftspflege häufiger Nester von Insekten versehentlich zerstört werden und es dadurch zu Insektenstichen kommen kann. Das Gift von Wespen und Bienen, aber auch von Hornissen oder Hummeln ist in der Regel erst bei einer großen Anzahl von Stichen gefährlich. Ungefähr 5 Prozent der Bevölkerung reagieren allerdings allergisch auf Insektenstiche. Hier kann bereits ein einziger Stich einen anaphylaktischen Schock auslösen. Ein anaphylaktischer Schock ist eine akute lebensbedrohliche Reaktion des Immunsystems.
Eichenprozessionsspinner
Auch Teile von Tieren, wie beispielsweise die kleinen Härchen von Eichenprozessionsspinnern, können zu erheblichen Beeinträchtigungen führen. Der Eichenprozessionsspinner ist ein Schmetterling (Nachtfalter). Er selbst ist harmlos, allerdings weisen seine Raupen als Fressschutz Brennhaare auf, die das Nesselgift Thaumetopoein enthalten. Dieses ist als Auslöser irritativer und entzündlicher Reaktionen bei Mensch und Tier bekannt. Die Raupen des Eichenprozessionsspinners schlüpfen im Mai und fressen die Knospen und Blätter von Eichenbäumen.
Sie leben auf den befallenen Bäumen in Gruppen und bewegen sich zur Nahrungssuche in Prozessionen. (s. Abb. 11) Im späten Frühjahr werden die Härchen der Raupen durch Regen und Wind verteilt. Die Bruchstücke reichern sich besonders im Unterholz sowie im Bodenbewuchs an. Sie können so immer wieder neue Gesundheitsbeschwerden auslösen und bleiben über Jahre gefährlich.
Unmittelbar nach einem Hautkontakt entwickelt sich ein Brennen auf der Haut bzw. ein sehr unangenehmer Juckreiz, dem ein Ausschlag folgt. Bei Kontakt mit dem Auge kann es zu einer akuten Bindehautentzündung mit Rötung und Schwellung der Augenlider kommen. Das Einatmen der Härchen kann eine Entzündung der Atemwege hervorrufen.
Schließlich sind auch Allgemeinsymptome wie Schwindelgefühl, Benommenheit, Fieber, Schüttelfrost und, in seltenen Fällen, Schockzustände bekannt.

|

|

|
Abb. 11 Eichenprozessionsspinner |
Abb. 12 Gefahrenhinweis auf befallene Flächen |
Abb. 13 Erdwespennest |
Pflanzen und Pflanzenteile
Auch Pflanzen oder Pflanzenteile können zu Gefährdungen führen. In die Haut eindringende Pflanzenteile (Splitter, Dornen, Stacheln) sind häufig stark keimbesiedelt und können zu Infektionen führen.
Die Pollen der Beifuß-Ambrosie sind stark Allergie auslösend und um ein Vielfaches aggressiver als alle Gräser-Pollen zusammen. Sie können Heuschnupfen und Asthma hervorrufen. Allein die Berührung von Ambrosia-Pflanzen kann zu allergischen Hautreaktionen führen. Die Beifuß-Ambrosie breitet sich zunehmend aus. (s. Abb. 15)
Alle Pflanzenteile der Herkulesstaude enthalten eine gefährliche Substanz, Furocumarin, die bei Kontakt mit dem Pflanzensaft auf die Haut gelangen kann. (s. Abb. 14) Bei Sonneneinstrahlung bildet Furocumarin zusammen mit körpereigenem Eiweiß ein Antigen, das zu einer starken allergischen Reaktion (phototoxische Reaktion) führen kann. Auf der Haut bilden sich Blasen, die an eine schwere Verbrennung erinnern und eine Verfärbung wird hervorgerufen, die monatelang anhalten kann.
Sonstige Gefährdungen in öffentlichen Grünanlagen
Öffentliche Grünanlagen werden leider auch als Müllabladeplatz oder Hundetoilette missbraucht. Bei Grünpflegearbeiten in derartigen Anlagen kommen Beschäftigte häufig unfreiwillig in Kontakt mit z. B. Fixerbestecken, Kondomen, Hundekot.
Verletzungen an benutztem Fixerbesteck können beispielsweise zu Hepatitisinfektionen führen. (s. Abb. 16)
Durch Hundekot können zahlreiche Bakterien, Viren und Parasiten (z. B. Bandwürmer) übertragen werden. (s. Abb. 17)

|

|
Abb. 14 Herkulesstaude |
Abb. 15 Ambrosia |

|

|
Abb. 16 Gefährlicher Abfall in der Grünfläche |
Abb. 17 Hundekot |
Stellen Sie sicher, dass, abhängig von der Gefährdungsbeurteilung, gegen diese und weitere mögliche Gefährdungen folgende Maßnahmen getroffen werden:
Zecken
- Unterweisung der Beschäftigten über die von Zecken ausgehenden Gesundheitsgefahren und mögliche Krankheitssymptome sowie über die zu treffenden Schutzmaßnahmen.
- Geschlossene Kleidung (lange Hosen) tragen, gegebenenfalls Repellentien (Insektenschutzmittel) verwenden.
- Absuchen von Kleidung und Haut nach der Arbeit.
- Zecken nach einem Stich möglichst schnell und sachgerecht, z. B. mit einem Zeckenentferner, entfernen, um das Risiko von Infektionen und Erkrankungen zu minimieren.
- Bei auftretenden Komplikationen nach einem Zeckenstich (Wanderröte, Fieber, Schwellungen u. a.) umgehend einen Arzt aufsuchen.
- Veranlassen der arbeitsmedizinischen Vorsorge (hier: Pflichtvorsorge). In Endemiegebieten ist nach entsprechender ärztlicher Beratung ein Impfangebot (FSME) zu unterbreiten.
Tetanus
- Auf ausreichenden Impfschutz bei den Beschäftigten achten.
- Vermeidung von mechanischen Hautverletzungen.
- Verwendung geeigneter Schutzhandschuhe bei starker mechanischer Beanspruchung der Hände.
- Maßnahmen des Hautschutzes (Hautschutz vor der Arbeit, schonende Hautreinigung, gezielte Hautpflege nach der Arbeit).
- Wundversorgung auch nach Kleinverletzungen (Pflaster).
Hanta-Virus
- Bei Reinigungs- und Aufräumarbeiten, Umsetzen von Komposthaufen u. ä. nach Möglichkeit das Aufwirbeln von Stäuben vermeiden.
- Bei Arbeiten in befallenen Bereichen partikelfiltrierende Atemschutzmaske (FFP3) tragen und nach Gebrauch entsorgen.
- Bei der Tätigkeit weder Essen, Trinken noch Rauchen.
- Nach der Arbeit Hände und Werkzeuge gründlich reinigen.
Insektenstiche
- Vor Arbeitsbeginn, z. B. bei Freischneide- und Heckenschneidearbeiten, auf Anzeichen von Insektennestern achten. Zu erkannten Insektennestern ausreichend Abstand halten.
- Festlegung besonderer Maßnahmen bei gegen Insektenstiche allergisch reagierenden Beschäftigten.
Eichenprozessionsspinner (EPS)
- Solange Nester erkennbar sind, auf Baumarbeiten verzichten. Befallene Bereiche meiden.
- Bekämpfung nur durch Spezialisten in entsprechender Schutzkleidung.
- Nach ungewolltem Kontakt mit Raupenhaaren intensiv duschen. Kontaminierte Kleidung wechseln und waschen.
- Erkannten Befall der regional zuständigen Stelle melden (z. B. Grünflächenamt, Ordnungsamt).
Pflanzen und Pflanzenteile
- Zum Schutz vor Dornenstichen durchstichhemmende Schutzhandschuhe tragen.
- Körper bedeckende Arbeits- oder Schutzkleidung tragen (Beifuß-Ambrosie, Herkulesstaude).
- Augenschutz verwenden, Hautberührungen mit Pflanzenteilen und -saft vermeiden, Arbeiten nicht bei starker Sonneneinstrahlung durchführen (Herkulesstaude).
- Atemschutz (P2) verwenden (Beifuß-Ambrosie)

Abb. 18 Fachgerechte Ambrosiabekämpfung
Sonstige Gefährdungen in öffentlichen Grünanlagen
Bei der Möglichkeit der Verletzung durch Fixerbesteck:
- Benutzung von Hilfsmitteln (Greifzangen) zum Aufsammeln.
- Verwendung von stichhemmenden Schutzhandschuhen.
- Spritzen, Kanülen usw. in durchstichsicheren Behältern (keine Plastikmüllsäcke) sammeln und sachgerecht entsorgen.
- Nach Verletzungen direkt in ärztliche Behandlung begeben.
Bei der Möglichkeit des Kontaktes zu Tierkot, insbesondere Hundekot:
- In besonders belasteten Bereichen solche Arbeitsverfahren auswählen, die das Aufwirbeln oder Umherschleudern von Kot reduzieren oder vermeiden (möglichst nicht Laubbläser oder -sauger verwenden; Rasenmäher oder Freischneider mit Schutzkonstruktionen wie Prallschürzen o. ä. ausrüsten).
- Bei der Reinigung kontaminierter Arbeitsmittel (Rasenmäher, Freischneider, etc.) den Kontakt zu Kot vermeiden.
 Erste Hilfe
Erste Hilfe
Auch kleinere Verletzungen – z. B. Dornenstiche, Insekten- und Zeckenstiche – konsequent in das Verbandbuch eintragen!
Diese Aufzeichnungen dienen als Nachweis, dass eine Verletzung bei einer beruflichen Tätigkeit entstanden ist. Sie können wichtig sein, wenn z. B. Spätfolgen eintreten sollten.
3.3 Arbeiten im öffentlichen Verkehrsraum
Grün- und Landschaftspflegearbeiten finden oft im öffentlichen Verkehrsraum oder in dessen Grenzbereich statt. Hier können für Ihre Beschäftigten Gefährdungen durch den fließenden Verkehr bestehen, die es zu vermeiden gilt. Auch die Verkehrsteilnehmenden dürfen durch Ihre Arbeiten nicht gefährdet werden. Es kommt also auf eine sorgfältige Planung und Einrichtung der Arbeitsstelle an.

|
Rechtliche Grundlagen
|
- Straßenverkehrsordnung (StVO)
- Verwaltungsvorschrift zur StVO (VwV-StVO)
- Richtlinien für die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen (RSA95)
- Technische Regeln für Arbeitsstätten "Anforderungen an Arbeitsplätze und Verkehrswege auf Baustellen im Grenzbereich zum Straßenverkehr" (ASR A5.2)
- DGUV Regel 114-016 "Straßenbetrieb, Straßenunterhalt"
|
|
Weitere Informationen
|
- DGUV Information 212-016 "Warnkleidung"
- Merkblatt über Rahmenbedingungen für erforderliche Fachkenntnisse zur Verkehrssicherung von Arbeitsstellen an Straßen (MVAS 99)
|
|
Gefährdungen
|
|
Bei Arbeitsplätzen der Grün- und Landschaftspflege können sich im Grenzbereich zum Straßenverkehr Gefährdungen insbesondere ergeben durch:
- den vorbeifahrenden Straßenverkehr,
- Lärm,
- Abgase,
- Witterungseinflüsse oder
- Sichtverhältnisse.
|
|
Maßnahmen
|
|
Stellen Sie sicher, dass, abhängig von der Gefährdungsbeurteilung, gegen diese und weitere mögliche Gefährdungen folgende Maßnahmen getroffen werden:
- Planen Sie die Arbeitsstellensicherung unter Berücksichtigung der Arbeitsabläufe, der Arbeitsverfahren, der Verkehrssituation, der Arbeitsbereiche und der örtlichen Platzverhältnisse sorgfältig.
- Stellen Sie einen Verkehrszeichenplan auf und holen Sie vor Beginn der Arbeiten, die sich auf den öffentlichen Straßenverkehr auswirken, eine verkehrsrechtliche Anordnung bei der zuständigen Straßenbaubehörde ein. Diese legt die Maßnahmen für die Beschilderung und Absperrung fest.
- Setzen Sie zur Abgrenzung von Arbeitsplätzen und Verkehrswegen vom fließenden Verkehr geeignete Verkehrseinrichtungen ein, z. B. Leitkegel, fahrbare Absperrtafeln, Warneinrichtungen, Lichtzeichenanlagen. Berücksichtigen Sie dabei auch erforderliche Sicherheitsabstände (siehe ASR A 5.2).
- Sorgen Sie dafür, dass Ihre Beschäftigten sich beim Auf- und Abbau von Arbeitsstellen im Verkehrsraum im Schutz der zur Sicherung aufgestellten Verkehrseinrichtungen aufhalten können. Das freie Bewegen auf Fahrbahnen ohne entsprechende Sicherung muss auf das unbedingt erforderliche Mindestmaß beschränkt bleiben.
- Richten Sie bewegliche Arbeitsstellen nur ein, wenn eine stationäre Absicherung einen unvertretbar hohen Aufwand bedeutet. Ein unvertretbar hoher Aufwand kann z. B. bei Mäharbeiten mit Geräteträgern gegeben sein.
- Warnposten sind besonderer Gefahr ausgesetzt. Sorgen Sie deshalb dafür, dass sie nur in Ausnahmefällen eingesetzt werden und ihre Tätigkeit darauf beschränkt ist, in umsichtiger Weise vor einer Verkehrseinschränkung oder Gefahrenstelle zu warnen. Stellen Sie sicher, dass Warnposten keine Verkehrsregelung vornehmen.
 Persönliche Schutzausrüstungen Persönliche Schutzausrüstungen
Stellen Sie Ihren Beschäftigten geeignete Warnkleidung zur Verfügung und sorgen Sie dafür, dass diese getragen wird. Die Auswahl der Klasse der Warnkleidung richtet sich nach der Gefährdung. Einfache Gefährdung erfordert mindestens Warnkleidung der Klasse 2 (z. B. Warnweste). Bei erhöhter Gefährdung ist Warnkleidung der Klasse 3 zu tragen.
Da einzelne Kriterien für erhöhte Gefährdung im Alltag immer wieder vorliegen, empfiehlt sich der grundsätzliche Einsatz von Warnkleidung der Klasse 3.
Beispiele für erhöhte Gefährdung:
- Schlechte Sichtverhältnisse Arbeiten in der Dunkelheit
- Verkehrsgeschwindigkeit > als 60 km/h
- > 600 Fahrzeuge pro Stunde Überqueren mehrspuriger Fahrbahnen Teile der Warnkleidung häufig tätigkeitsbedingt verdeckt
- Häufiger Wechsel zwischen abgesperrten und ungesicherten Arbeitsbereichen
- Arbeiten zum Aufbau einer Sicherung
Ein Kriterium erfüllt?
Warnkleidung Klasse 3! |
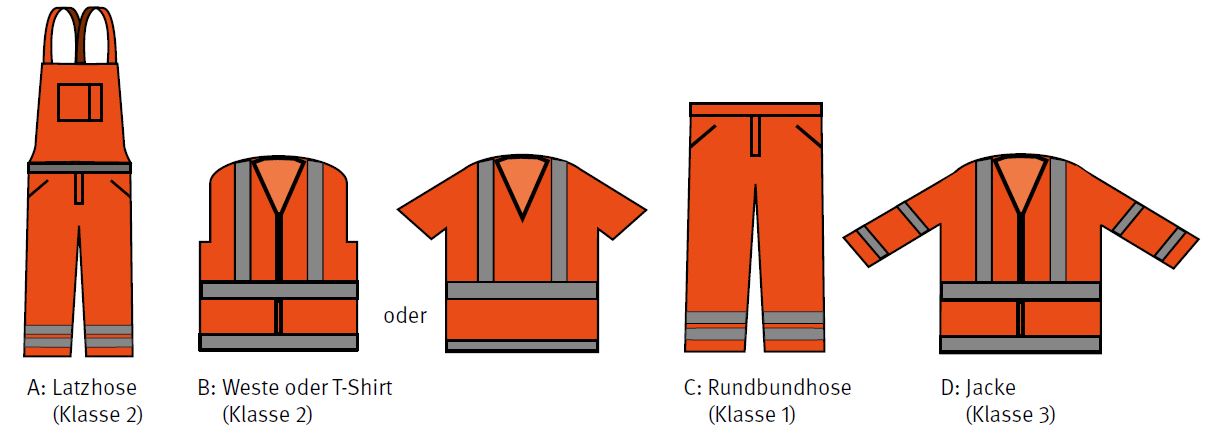
Abb. 20 Übersicht Warnkleidung
|
3.4 Arbeiten mit Maschinen, Geräten und Werkzeugen
In der Grün- und Landschaftspflege werden die unterschiedlichsten Arbeitsmittel eingesetzt: Handgehaltene Werkzeuge und Maschinen, handgeführte Bodenbearbeitungsmaschinen und Mäher, Maschinen mit Fahrersitz.
Ihr sicherer Einsatz stellt grundlegende Anforderungen an die Qualifikation und Eignung der Bediener und Bedienerinnen, aber auch an die korrekte Auswahl für den jeweiligen Einsatzzweck, die Ausrüstung, Instandhaltung und Wartung der Arbeitsmittel.

|
Gefährdungen
|
|
Beim Arbeiten mit Maschinen, Geräten und Werkzeugen können Gefährdungen zu Unfällen führen. Verletzungs- und Gesundheitsgefahren bestehen durch:
|
|
Maßnahmen
|
|
Stellen Sie sicher, dass, abhängig von der Gefährdungsbeurteilung, gegen diese und weitere mögliche Gefährdungen folgende Maßnahmen getroffen werden:
Beschaffung
- Beschaffen Sie Maschinen und Geräte nur, wenn die notwendigen Unterlagen vorliegen wie z. B. EG/EU-Konformitätserklärung, Bedienungsanleitung in deutscher Sprache, Prüfbescheinigungen. Dies gilt insbesondere auch beim Kauf von gebrauchten Maschinen und Geräten.
- Achten Sie bei der Beschaffung auf das GS-Zeichen (Geprüfte Sicherheit) und auf bewährte Gütesiegel wie z. B. vom KWF (Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik).
- Berücksichtigen Sie bei der Beschaffung auch ergonomische Grundsätze.
- Beziehen Sie die Anwender oder die Anwenderin sowie Ihre Fachkraft für Arbeitssicherheit bei der Auswahl und Beschaffung ein.
- Testen Sie die Geräte ggf. vor der Beschaffung unter ihren Einsatzbedingungen.
- Beschaffen Sie vibrations-, lärm- und abgasarme Maschinen. Bei handgeführten bzw. handgehaltenen Geräten stellen Akku-Geräte inzwischen eine gute Alternative zu Geräten mit Verbrennungsmotor dar.
Eignung und Qualifizierung
Arbeiten mit mobilen Arbeitsmitteln und handgeführten Maschinen dürfen nur von Personen ausgeführt werden, die neben der gesundheitlichen Eignung auch die fachliche Qualifikation besitzen und regelmäßig anhand der Bedienungsanleitungen und Betriebsanweisungen unterwiesen werden.

Abb. 23 Bedienelemente an einem Einachs-Schlepper
Beachten Sie, dass für eine Vielzahl von Maschinen und Geräten in der Grün- und Landschaftspflege weitergehende Anforderungen an die fachliche Qualifikation der Bediener bzw. Bedienerinnen gestellt werden und ausdrückliche Beauftragungen erforderlich sind. Dies sind z. B.:
| Arbeitsmittel |
Schriftliche Beauftragung |
Befähigungsnachweis z. B. zu erlangen durch |
| Lkw-Ladekran |
Ja |
Qualifikation nach DGUV Grundsatz 309-003 |
| Gabelstapler |
Ja |
Qualifikation nach DGUV Grundsatz 308-001 |
| Teleskopstapler |
Ja |
Qualifikation nach DGUV Grundsatz 308-009 |
| Hubarbeitsbühne |
Ja |
Qualifikation nach DGUV Grundsatz 308-008 |
| Motorsäge |
Empfohlen |
Qualifikation nach DGUV Information 214-059 |
| Bagger, Radlader |
Empfohlen |
ZUMBau Prüfnachweis* |
* ZUMBau: Zulassungsausschuss für Prüfungsstätten von Maschinenführern in der Bauwirtschaft
Bei der Beschäftigung von Jugendlichen sind Schutzalterbestimmungen sowie Beschäftigungsverbote und -beschränkungen zu beachten. Zum Beispiel:
- Bedienen von Freischneidern oder Motorsägen: Schutzalter 18 Jahre! (Bei Ausbildung unter Aufsicht eines Fachkundigen: Schutzalter 15 Jahre!)
- Bedienen von Heckenscheren, handgeführten Rasenmähern: Schutzalter 15 Jahre!
Bestimmungsgemäße Benutzung
Die bestimmungsgemäße Benutzung ist eine Voraussetzung für sicheres Arbeiten und verbietet eine Manipulation insbesondere an Schutzvorrichtungen. Sie ergibt sich aus der Betriebsanleitung des Herstellers und der von Ihnen zu erstellenden Betriebsanweisung.
Stellen Sie insbesondere sicher, dass Maschinen und Geräte nur betrieben werden, wenn
- die Vorgaben zur bestimmungsgemäßen Benutzung von Ihren Beschäftigten konsequent beachtet werden,
- alle vom Hersteller vorgesehenen Schutzeinrichtungen an Gefahrstellen wie Ketten- und Keilriemenantriebe, Zahnräder, Wellen, etc. vorhanden und wirksam sind,
- angebaute Bodenbearbeitungsgeräte (z. B. Bodenfräse) eine vollwandige Arbeitswerkzeugabdeckung aufweisen,
- Gelenkwellen eine voll funktionierende Verkleidung aufweisen. Diese besteht aus einer Plastikverkleidung, die alle Antriebselemente der Welle – inkl. Kreuzgelenke – verdeckt. Verdrehsicherungen (Ketten) verhindern das Mitdrehen des Plastikschutzes.
- Zapfwellenanschlüsse mit einem Sicherungsschild verdeckt sind,
- heiße Teile, z. B. am Auspuff, durch ein Gitter gegen großflächige Berührung gesichert sind,
- für die Bedienung des Gerätes erforderliche und geeignete Persönliche Schutzausrüstungen verwendet werden. (s. Abb. 24)
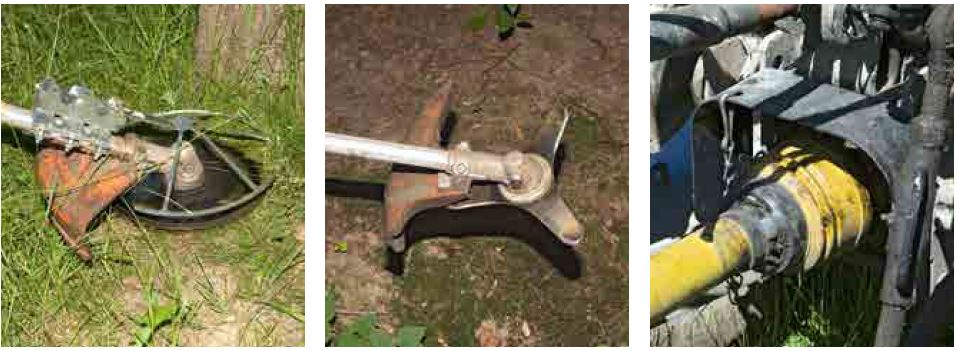
Abb. 24 Schutzeinrichtungen an Maschinen
Stellen Sie sicher, dass Reinigungs-, Wartungs- und Entstörungsarbeiten nur im gefahrlosen Zustand gemäß Betriebsanleitung des Herstellers ausgeführt werden. Treffen Sie auch Maßnahmen gegen irrtümliches Ingangsetzen und ungewollte Bewegungen. Beachten Sie dabei auch Gefahren durch nachlaufende Werkzeuge und gespeicherte Energien (s. Abb. 25).
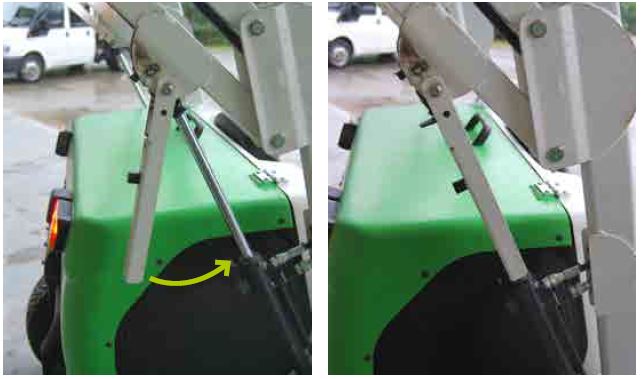
Abb. 25 Sicherung eines ausgefahrenen Arbeitszylinders
Berücksichtigen Sie beim Einsatz von handgeführten oder rückengetragenen Geräten die Möglichkeit von Über- und Fehlbelastungen des Muskel-Skelett-Systems.
Besonderen Einfluss auf Über- und Fehlbelastungen des Muskel-Skelett-Systems haben:
- Gerätegewicht
- Tragezeiten
- Ergonomische Gestaltung des Gerätes
- Individuelle körperliche Voraussetzungen
- Kenntnisse über die Handhabung des Gerätes
|
|
Weitere Informationen
|
- DGUV Information 214-046 "Sichere Waldarbeiten"
- DGUV Information 214-059 "Ausbildung für Arbeiten mit der Motorsäge und die Durchführung von Baumarbeiten"
- DGUV Information 250-010 "Eignungsuntersuchungen in der betrieblichen Praxis"
- DGUV Grundsatz 308-001 "Ausbildung und Beauftragung der Fahrer von Flurförderzeugen mit Fahrersitz und Fahrerstand"
- DGUV Grundsatz 308-008 "Ausbildung und Beauftragung der Bediener von Hubarbeitsbühnen"
- DGUV Grundsatz 308-009 "Qualifizierung und Beauftragung der Fahrerinnen und Fahrer von geländegängigen Teleskopstaplern"
- DGUV Grundsatz 309-003 "Auswahl, Unterweisung und Befähigungsnachweis von Kranführern"
- SVLFG Broschüre B06 "Körperschutz"
- SVLFG Broschüre B08 "Baumarbeiten"
- SVLFG Broschüre B24 "Erdbaumaschinen im Gartenbau"
- SVLFG Broschüre B30 "Grünpflege im Gartenbau"
- Betriebsanleitungen der Gerätehersteller
- Bekanntmachungen zur Betriebssicherheit "Beschaffung von Arbeitsmitteln" (BekBS 1113)
|
3.5 Einsatz von landwirtschaftlichen Fahrzeugen und selbstfahrenden Arbeitsmaschinen
Zur Grün- und Landschaftspflege kommen häufig land- oder forstwirtschaftliche
(lof) Fahrzeuge und selbstfahrende Arbeitsmaschinen zum Einsatz. Der Betrieb
und die Bedienung dieser Fahrzeuge bergen besondere Gefahren und stellen
entsprechende Anforderungen an die Bedienpersonen. Diese Fahrzeuge sind oft
besonders hoch, besitzen häufig Überlänge oder Überbreite. Gefährdungen
können auch von Anbaugeräten ausgehen. Einen besonderen Stellenwert für
den sicheren Betrieb hat die Qualifizierung der Bedienpersonen.

|
Weitere Informationen
|
- DGUV Information 211-031 "Einsatz von bordeigenen Kommunikations- und Informationssystemen mit Bildschirmen an Fahrerarbeitsplätzen"
- DGUV Information 250-010 "Eignungsuntersuchungen in der betrieblichen Praxis"
- DGUV Grundsatz 314-003 "Prüfung von Fahrzeugen durch Sachkundige"
- Broschüre "Land- oder forstwirtschaftliche Fahrzeuge im Straßenverkehr" (Herausgeber: Innenministerium Baden-Württemberg)
- Betriebsanleitungen der Fahrzeug-/Gerätehersteller
|
|
Gefährdungen
|
- Die Bedienperson ist nicht ausreichend qualifiziert.
- Die Bedienperson ist durch gleichzeitige Fahrtätigkeit und Bedienung von Arbeitsgeräten überfordert.
- Gefährdung von Personen im Gefahrenbereich von Anbaugeräten, Arbeitswerkzeugen und Hydraulikauslegern
- Eingeschränkte Sicht der Bedienperson auf das Arbeitsumfeld, z. B. durch Arbeitsgeräte oder Bauart
- Abrutschen/Abstürzen der Bedienpersonen, z. B. beim Auf- und Absteigen, bei Wartungs- oder Reinigungsarbeiten
- Umkippen/Abstürzen infolge unangepasster Fahrgeschwindigkeit, Arbeitsbewegung oder Arbeiten an Hängen bzw. Gräben
- Gefährliche Veränderung der Fahreigenschaften durch Anbaugeräte (z. B. infolge von Überschreitungen der Rad-/Achslasten und/oder des zulässigen Gesamtgewichts)
- Gefährdungen durch Absturz, überrollt oder gequetscht werden wegen Mitfahrt auf ungeeigneten Mitfahrplätzen
- Gefährdungen durch Anbaugeräte (z. B. durch den Schwenkbereich beim Betrieb der Anbaugeräte oder beim Fahren im Straßenverkehr bzw. durch weggeschleuderte Gegenstände). Siehe auch Kapitel 3.7.2 und 3.7.3.
- Verkehrsunfall durch Überschreitung zulässiger Vorbaumaße
- Gefährdung im Straßenverkehr durch Überbreite/Überlänge
- Gefährdungen beim An- und Abkuppeln von Anhängern
- Gefährdungen bei Wartungs- und Rüstarbeiten, z. B.
- An- und Abbau von Arbeitsgeräten, Zusatzgewichten und anderen Zusatzeinrichtungen (Hydrauliktanks, o. ä.)
- Arbeiten unter angehobenen Lasten
- Aufenthalt im Gefahrbereich von Knicklenkungen
|
|
Maßnahmen
|
|
Stellen Sie sicher, dass, abhängig von der Gefährdungsbeurteilung, gegen diese und weitere mögliche Gefährdungen folgende Maßnahmen getroffen werden:
Eignung und Qualifizierung
Sie haben darauf zu achten, dass Ihre Beschäftigten in der Lage sind, Ihre land- oder forstwirtschaftlichen Fahrzeuge bzw. selbstfahrenden Arbeitsmaschinen zu bedienen, ohne sich oder andere Personen zu gefährden. Dies betrifft sowohl die fachliche als auch die körperliche Eignung der Bedienpersonen. Die Bedienperson verfügt über die notwendige Qualifikation und die entsprechende Fahrerlaubnis.
Feststellung der körperlichen Eignung
Hierzu hat sich eine Untersuchung nach dem DGUV Grundsatz G25 "Fahr-, Steuer- und Überwachungstätigkeiten" bewährt. |
Die Betriebsanleitung des Herstellers wird mitgeführt und beachtet, da sie wichtige Hinweise zum sicheren Betrieb enthält.
Weitere Maßnahmen
Grundregel beim Auf- und Absteigen
Vorwärts rauf, rückwärts runter! Nicht Herabspringen, da hierbei eine besonders hohe Verletzungsgefahr besteht. |
| Verkehrssicherheit + Arbeitssicherheit = Betriebssicherheit |
Ermitteln Sie in diesen Fällen, welche zusätzlichen Prüfungen aus Sicht des Arbeitsschutzes erforderlich sind.
|
3.6 Bodenbearbeitung und Pflanzarbeiten
Die Bodenbearbeitung für Ansaat- und Pflanzarbeiten wird häufig mit Anbaugeräten an Einachsschleppern und mit Motorhacken durchgeführt. Daneben können auch andere Spezialmaschinen eingesetzt werden, wie beispielsweise Rasenbaumaschinen, Vertikutierer oder Aerifizierer. Diese Arbeiten stellen hohe Anforderungen an die jeweilige Bedienperson und es bestehen spezifische Unfallgefahren. Insbesondere kann es beim nicht bestimmungsgemäßen Einsatz der Maschinen zu Bein- und Fußverletzungen oder zu Verletzungen durch hochgeschleuderte Gegenstände kommen.
Pflanzarbeiten, bei denen bodenbedeckende Stauden, Sträucher und Bäume gepflanzt werden, sind oft mit enormen körperlichen Belastungen und Beanspruchungen verbunden und stellen daher aus ergonomischer Sicht eine Herausforderung dar.

|
Gefährdungen
|
|
Beim Arbeiten mit Bodenbearbeitungs- und Pflanzmaschinen können folgende Gefährdungen auftreten:
- Verletzungsgefahr durch die Arbeitswerkzeuge beim Starten bzw. Anlaufen der Maschine sowie beim Rückwärtsfahren
- Verletzungsgefahr durch die Arbeitswerkzeuge oder die Maschine beim Arbeiten am Hang
- Verletzungsgefahr durch wegfliegende Fremdkörper (Steine, Glasscherben, Metallteile, …)
- Gesundheitliche Belastungen durch Vibrationen, Lärm, Abgase, organische Stäube oder schlechte ergonomische Gestaltung der Maschine
Bei manuellen Pflanzarbeiten können folgende Gefährdungen auftreten:
| Andauernde kniende Arbeitshaltung führt zu einer extremen Beanspruchung des Kniegelenkes, verbunden mit vorzeitigem Gelenksverschleiß. Bei längerem Sitzen im Fersensitz sind Durchblutungsstörungen möglich. |
|
|
Maßnahmen bei der Bodenbearbeitung
|
|
Stellen Sie sicher, dass bei der Bodenbearbeitung mit Bodenbearbeitungs- und Pflanzmaschinen, abhängig von der Gefährdungsbeurteilung, gegen diese und weitere mögliche Gefährdungen folgende Maßnahmen getroffen werden:
Auswahl und sicherer Zustand der Maschine
- Es werden Maschinen beschafft, die hinsichtlich ihrer Leistungsparameter, Leistungsgrenzen und Einsatzbeschränkungen für die zu realisierenden Arbeitsaufgaben geeignet und sicher sind. Bevorzugt sind dies GS-geprüfte Maschinen.
Herstellerangaben zu Lärm und Vibrationen
| Ausführung |
Schallleistungspegel
[dB (A)]/
[U/min.] |
Schalldruckpegel
[dB (A)]/
[U/min.] |
Vibrationen
[m/s2] |
| Modell A |
102,1 |
87,2 |
4,2 |
| Modell B |
101,2 |
95,7 |
4,1 |
| Modell C |
103,7 |
87,1 |
4,2 |
- Einsatzzeitbeschränkungen, die sich durch Lärm und Vibrationen ergeben können sind zu beachten. Beschaffen Sie daher Maschinen, die möglichst lärm- und vibrationsarm arbeiten. Vergleichen Sie dazu vor der Beschaffung die produktbezogenen technischen Daten verschiedener Hersteller.
- Beim Wechseln von Anbaugeräten und Zusatzeinrichtungen werden die Hinweise in der Bedienungsanleitung bzw. Montageanleitung der Hersteller berücksichtigt. Sicherheitskonzepte der Komponenten sind kompatibel (z. B. zwanghafte Werkzeugverriegelung beim Anbau einer Bodenfräse an einen Einachsschlepper).
- Schutzeinrichtungen müssen montiert und wirksam sein (z. B. Werkzeugabdeckungen, Sicherheitsschalter).
- Schutzabdeckungen über den Arbeitswerkzeugen müssen auf die jeweilige Boden- bzw. Bearbeitungstiefe eingestellt sein.
- Die Führungsholme der Maschine sind auf die Körpermaße der Bedienperson eingestellt.
- Vor Arbeitsbeginn wird stets eine Sicht- und Funktionsprüfung in Bezug auf den sicheren Zustand der Maschine durchgeführt.
Betrieb der Maschine
- Die Maschinen werden nur von geeigneten und unterwiesenen Personen bedient. Diese haben den schnellen Einsatz der Notabschalteinrichtungen trainiert.
- Die Maschine ist möglichst auf ebenem Gelände zu starten.
- Beim Starten ist der Leerlauf eingelegt. Für Motorhacken gilt: Die Bedienperson befindet sich seitlich hinter der Maschine. Für Einachsschlepper mit angebauter Fräse gilt: Der Antrieb für die Fräswerkzeuge ist abgeschaltet und wird erst kurz vor Arbeitsbeginn zugeschaltet.
- Bei der Arbeit mit Einachsschleppern mit angebauter Fräse ist
- vor Wendemanövern,
- vor dem Rückwärtsfahren oder
- beim Wechsel des Einsatzortes der Werkzeugantrieb auszustellen.
- Die Angaben und Sicherheitshinweise des Herstellers der Maschine für Arbeiten am Hang (z. B. maximal zulässiger Böschungswinkel) sind einzuhalten.
- An Böschungen und am Hang wird immer quer zum Hang (nie hang auf oder hang ab) gearbeitet.
- Wenn möglich, wird die Maschine zusätzlich am Hang gesichert, z. B. durch die Anbringung von Zwillingsbereifung oder geeignete Zusatzeinrichtungen wie Metall-Speichen-Räder. Bei Einachsschleppern mit verstellbarer Spurbreite wird möglichst die größte Spurbreite gewählt.
- Bei der Bodenbearbeitung mit Einachsschleppern und Motorhacken wird ein ausreichender Sicherheitsabstand zu Zäunen, baulichen Einrichtungen, Wegeinfassungen, befestigten Wegen und Fahrbahnflächen eingehalten.
- Beim Einsatz von Einachsschleppern mit Sitzkarren im öffentlichen Straßenverkehr sind die Vorgaben der StVO und StVZO zu beachten (z. B. Beleuchtung, Handbremse).
Reinigungs- und Wartungsarbeiten, Störungsbeseitigung
- Die Maschinen werden nach Herstellerangaben bestimmungsgemäß gewartet und repariert.
-
Instandhaltungsarbeiten werden nur von Personen durchgeführt, die hierfür die notwendigen Kenntnisse und Fähigkeiten besitzen.
-
Vor Reinigungs-, Wartungs- und Einstellungsarbeiten bzw. vor Beseitigung von Störungen oder dem Entfernen von Fremdkörpern bzw. bei längeren Arbeitsunterbrechungen ist der Gesamtantrieb der Maschine abzustellen. Maßnahmen gegen irrtümliches Ingangsetzen und ungewollte Bewegungen sind zu treffen. Gefährdungen durch nachlaufende Teile oder gespeicherte Energien sind zu berücksichtigen.
|
|
Maßnahmen bei Pflanzarbeiten
|
|
Stellen Sie sicher, dass bei Pflanzarbeiten abhängig von der Gefährdungsbeurteilung, gegen die oben genannten und weitere mögliche Gefährdungen folgende Maßnahmen getroffen werden:
- Die Beschäftigten sind über ergonomisches Verhalten (z. B. rückengerechtes Verhalten oder den richtigen Einsatz von ergonomischen Hilfsmitteln) unterwiesen und haben den richtigen Einsatz trainiert.
- Ergonomische Hilfsmittel, wie z. B. Knieschoner, Kniehocker, Pfahlrammen, stehen zur Verfügung. Die verwendeten Handwerkzeuge (z. B. Pflanzspaten) verfügen über die für die jeweiligen Beschäftigten geeignete Stiellänge und eine ergonomische Gestaltung (z. B. Griffgestaltung). (s. Abb. 31)
- Bei Pflanzstellen in unmittelbarer Nähe zum öffentlichen Straßenverkehr werden die Schutzmaßnahmen entsprechend Kapitel 3.3. getroffen.

Abb. 31 Kniekissen
 Persönliche Schutzausrüstungen Persönliche Schutzausrüstungen
Bei Arbeiten mit Bodenbearbeitungs- und Pflanzmaschinen ist geeigneter Körperschutz, bestehend mindestens aus Gehörschutz, Sicherheitsschuhen und Schutzhandschuhen zu tragen. Beachten Sie auch weitergehende Angaben in der Bedienungsanleitung des Herstellers.
|
|
Weitere Informationen
|
- DGUV Information 212-016 "Warnkleidung"
- VSG 3.1 "Technische Arbeitsmittel" §§ 43, 44
- Merkblatt über Rahmenbedingungen für erforderliche Fachkenntnisse zur Verkehrssicherung von Arbeitsstellen an Straßen (MVAS 99)
- Betriebsanleitungen der jeweiligen Hersteller der Maschinen
- SVLFG Broschüre B42 "Baumschule"
- Richtlinien für die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen (RSA95)
- ASR A5.2 "Anforderungen an Arbeitsplätze und Verkehrswege auf Baustellen im Grenzbereich zum Straßenverkehr – Straßenbaustellen"
|
3.7 Grünpflegearbeiten
3.7.1 Mäharbeiten mit handgeführten Mähgeräten
Bei kleinflächigen Mäharbeiten kommt meist der handgeführte Sichelmäher zum Einsatz. Daneben werden in der extensiven Grünpflege Mulchmäher eingesetzt. Trotz ausgereifter Sicherheitstechnik treten immer wieder schwere Hand- und Fußverletzungen durch Bedienungsfehler auf. Auch wenn diese Geräte in vielen Privathaushalten zu finden sind, ist im betrieblichen Bereich eine ausführliche Ein- und Unterweisung in die Bedienung unerlässlich.
|
Weitere Informationen
|
- DGUV Information 214-057 "Gärtnerische Arbeiten"
- SVLFG Broschüre B30 "Grünpflege im Gartenbau"
- SVLFG Broschüre B06 "Körperschutz"
- Betriebsanleitungen der Hersteller
|
|
Gefährdungen
|
|
Bei Mäharbeiten treten häufig folgende Gefährdungen auf:
- Verletzungsgefahr durch Hineingreifen oder Hineintreten in schnell rotierende oder nachlaufende Messerwerkzeuge
- Getroffen werden durch weggeschleuderte Gegenstände (z. B. Fremdkörper, Messerbruchstücke)
- Stolpern, Ausrutschen und Fallen beim Rückwärtsziehen
- Verbrennungsgefahr durch heiße Maschinenteile
- Gehörschädigung durch Lärm
- Gesundheitsgefahren durch aufgewirbelten Tierkot
|
|
Maßnahmen
|
|
Stellen Sie sicher, dass, abhängig von der Gefährdungsbeurteilung, gegen diese und weitere mögliche Gefährdungen folgende Maßnahmen getroffen werden:
- Für die Schnittaufgabe (Bewuchshöhe) stehen geeignete Mäher zur Verfügung, z. B. Mulchmäher für hohen Bewuchs.
- Durch Einweisung, Unterweisung und Kontrolle ist sichergestellt, dass Mäher bestimmungsgemäß verwendet werden.
- Vor Arbeitsbeginn und nach Auffahrt auf ein Hindernis wird das Messer auf seinen einwandfreien Zustand und festen Sitz geprüft. Beschädigte Messer sofort auswechseln!
- Zum Beseitigen von Verstopfungen oder Verstellen der Schnitthöhe ist es in der Regel erforderlich, unter das Gehäuse zu fassen. Dies darf nur erfolgen, wenn der Motor abgestellt ist und die Schneidwerkzeuge stillstehen.
- Sicherheitseinrichtungen (z. B. Schutzgitter am Auspuff, Fangkorb/Prallblech, Schutztuch, Totmannschaltung) sind vorhanden und funktionsfähig.
- Erkennbare Fremdkörper wie Flaschen, Steine und Blechdosen werden vor den Mäharbeiten entfernt.
- Sicherheitsabstände werden eingehalten.
| Beim Führen der Mäher außerhalb der Pflegefläche ist das Mähwerk auszuschalten! |
 Persönliche Schutzausrüstungen Persönliche Schutzausrüstungen
- Sie sind verpflichtet, Ihren Beschäftigten geeignetes Schuhwerk zur Verfügung zu stellen. Mindestanforderungen: Trittsichere Sohle und Zehenschutz.
- Sie sind ebenfalls verpflichtet, Ihren Beschäftigten die Arbeitskleidung zur Verfügung zu stellen und zu reinigen, wenn diese zugleich als Schutzkleidung dient, z. B. bei Mähflächen, auf denen mit Tierkot zu rechnen ist. Sie muss körperbedeckend sein.
- Bei länger andauernden Mäharbeiten mit lärmintensiven Maschinen kann zusätzlich Gehörschutz erforderlich sein.
Beste Praxis
Fachgerechtes Schleifen und Kontrollieren auf Unwuchten verhindert Messerbrüche und Motorschäden! |

|

|

|
Abb. 34 Sicherheitseinrichtung |
Abb. 35 Sicherheitseinrichtung
in Funktion |
Abb. 36 Prallschutz |
|
3.7.2 Mäharbeiten mit Aufsitzmähern und Anbaugeräten
Sind größere Flächen zu bearbeiten, kommen meistens Aufsitzrasenmäher oder
Schlepper mit Anbaumähgerät zum Einsatz. Eine (optionale) Fahrerkabine bietet
dem Bediener oder der Bedienerin Schutz vor Umwelteinflüssen. Der Einsatz
birgt viele Gefahren, die auch bei Handrasenmähern auftreten: Verletzungsgefahr
an den Schneidwerkzeugen, Körper- und Sachschäden durch herausgeschleuderte
Fremdkörper, Umkippen am Hang, Lärm. Zusätzlich ist auf Ganzkörpervibrationen,
Gefährdungen bei Grassammelcontainern und Sauggebläsen
sowie auf Besonderheiten bei Straßenfahrt zu achten.
|
Weitere Informationen
|
- SVLFG Broschüre B30 "Grünpflege im Gartenbau"
- Betriebsanleitungen der Gerätehersteller
|
|
Gefährdungen
|
- Herausgeschleuderte Fremdkörper können zu Körper- und Sachschäden führen.
- Hände und Füße können beim Aus- oder Abrutschen in das Mähwerk geraten.
- Das Befahren von Hängen und Böschungen ist häufig mit einer großen Kippgefahr verbunden.
- Beim Umkippen von Aufsitzmähern oder Schleppern kann die Bedienperson verletzt werden, z. B. wenn sie abspringt, herausgeschleudert oder von der kippenden Maschine getroffen wird.
- Bei Arbeiten unter angehobenen Grassammelcontainern besteht durch plötzliches Versagen der Hydraulik tödliche Quetschgefahr.
- Es besteht die Gefahr von Muskel-Skelett-Erkrankungen durch Ganzkörpervibrationen.
- Gefährdungen durch den Straßenverkehr bei Umsetzfahrten.
|
|
Maßnahmen
|
|
Stellen Sie sicher, dass, abhängig von der Gefährdungsbeurteilung, gegen diese und weitere mögliche Gefährdungen folgende Maßnahmen getroffen werden:
|
3.7.3 Mäh- und Schnittarbeiten mit Auslegergeräten
Mäh- und Schnittgeräte an Auslegern kommen hauptsächlich bei der Pflege von Randstreifen und Böschungen sowie beim Schnitt von Lichtraumprofilen an Straßen zum Einsatz. Sie werden einzeln oder auch in Kombination an Front-, Heck- oder Zwischenachsauslegern von Trägerfahrzeugen oder Traktoren angebaut. Durch bestimmungsgemäßen Einsatz und intakte Schutzvorrichtungen an den Geräten können Gefahren durch weggeschleuderte Gegenstände minimiert werden. Da die Arbeiten meist im Straßenverkehr und mit langsamer Fahrt erfolgen, sind auch die Sicherung der Arbeitsstelle und die Erkennbarkeit des Trägerfahrzeugs von großer Bedeutung.
|
Weitere Informationen
|
- DGUV Information 214-050 "Arbeitsschutz beim Straßenunterhaltungsdienst – Ein Tag beim Sommerdienst"
- Betriebsanleitungen der Gerätehersteller
- Verwaltungsvorschrift "Merkblatt für Anbaugeräte" (AnbauGerMBl:2009-11-27, VkBI. 2009, S. 804)
|
|
Gefährdungen
|
|
Beim Betrieb von Auslegergeräten können folgende Gefährdungen bestehen:
- Die Fahreigenschaften des Trägerfahrzeugs werden allgemein durch die Anbaugeräte beeinflusst. Bei unsachgemäßer Montage von Auslegern kann es zu erheblichen Beeinträchtigungen der Verkehrs- und Betriebssicherheit kommen (z. B. Brems- oder Lenkprobleme durch Unterschreitung der Mindestlasten bzw. Überschreiten der Höchstlasten an den einzelnen Achsen; Umkippen des Trägerfahrzeugs).
- Aufgrund der langsamen Fahrgeschwindigkeit beim Einsatz können – insbesondere auf unübersichtlichen Strecken – Gefährdungen durch Kollisionen mit anderen Verkehrsteilnehmern bestehen. Durch Ausleger und Anbaugeräte können Sicherheitskennzeichnungen oder Beleuchtungseinrichtungen des Trägerfahrzeugs verdeckt sein und dadurch die Erkennbarkeit des Fahrzeugs beeinträchtigen.
- Das Steuern des Trägerfahrzeugs und gleichzeitiges Bedienen von Auslegern und Anbaugeräten erfordern hohe Aufmerksamkeit und Konzentration. Dies kann insbesondere bei lang andauernden Tätigkeiten zur Überforderung und in der Folge zu unfallverursachenden Fehlhandlungen führen. (s. Abb. 45)

Abb. 45 Anspruchsvolle Bedienung gleichzeitig arbeitender Mähwerke
- Ausleger und Anbaugeräte können zu Sichteinschränkungen auf den Verkehrsraum und den Arbeitsbereich führen. (s. Abb. 46)

Abb. 46 Sichteinschränkung durch Auslegergeräte
- Trotz vorhandener Schutzeinrichtungen können durch die Arbeitswerkzeuge Gegenstände (z. B. Schnittgut, Fremdkörper) weg- bzw. hochgeschleudert werden und zu Körper- und Sachschäden führen. Sowohl in der Umgebung als auch im Trägerfahrzeug können Personen getroffen werden.
- Bei Arbeiten an den Mäh- bzw. Schnittgeräten (z. B. Einstellarbeiten, Montage von Schutzeinrichtungen, Störungsbeseitigung) können Verletzungsgefahren durch bewegliche bzw. rotierende Teile oder auch durch nachlaufende Werkzeuge bestehen.
- Beim An- und Abbau von Auslegern und Anbaugeräten können verschiedene Gefährdungen bestehen (z. B. Kippen des Anbaugerätes, Quetschgefahren zwischen Bauteilen, herausspritzende Hydraulikflüssigkeiten, Schnittverletzungen an scharfkantigen Werkzeugen oder Maschinenteilen, heiße Oberflächen).
- Bei Annäherung oder Kontakt von Auslegern oder Anbaugeräten an bzw. mit Freileitungen kann es zu Stromübertritt kommen.
|
|
Maßnahmen
|
|
Stellen Sie sicher, dass, abhängig von der Gefährdungsbeurteilung, gegen diese und weitere mögliche Gefährdungen folgende Maßnahmen getroffen werden:
- Die zulässigen Vorbau-, Längen-, Breiten- und Höhenmaße sind einzuhalten. Überschreitungen des Vorbaumaßes ergeben sich insbesondere beim Einsatz von Traktoren.
- Erforderliche Gegengewichte werden nach Herstellerangaben angebracht.
- Zulässiges Gesamtgewicht, zulässige Achslasten und Lastverteilung des Trägerfahrzeugs werden beachtet.
- Überprüfen Sie, ob durch Ausleger oder Anbaugeräte am Trägerfahrzeug die Beleuchtung oder die für die Inanspruchnahme von Sonderrechten erforderliche Sicherheitskennzeichnung (rot-weiß-rote Schraffur) verdeckt oder überbaut sind. Bringen Sie in diesem Fall unter Berücksichtigung der StVO/StVZO zusätzliche Beleuchtung und Sicherheitskennzeichnungen an.
- Installieren und nutzen Sie zusätzliche Spiegel und/oder Kamera-Monitor-Systeme um Sichteinschränkungen auf den Verkehrsraum und den Arbeitsbereich zu minimieren.
- Durch Zusatzausrüstungen am Trägerfahrzeug können Ergonomie und die Sicht auf Verkehrsraum und Arbeitsbereiche verbessert werden. (s. Abb. 47)

Abb. 47 Verbesserte Ergonomie und Sicht durch Mähtür und Drehsitz
- Die Arbeitsgeräte werden bestimmungsgemäß eingesetzt (siehe Betriebsanleitung des Herstellers). Dies betrifft auch die Nutzung spezieller Schutzeinrichtungen bei besonderen Einsätzen, wie z. B. beim Mähen von Gestrüpp oberhalb von Schutzplanken. (s. Abb. 48)

Abb. 48 Spezielle Schutzabdeckung für das Mähen auf Schutzplanken
- Die Schutzeinrichtungen (z. B. Schutzabdeckungen, Schleuderschutzketten oder Gummischürzen) und die Werkzeuge an den Geräten werden mindestens täglich vor Arbeitsbeginn durch den Bediener oder die Bedienerin auf erkennbare Schäden, vollständige Montage und Funktionsfähigkeit geprüft.
- Der Fahrer oder die Fahrerin bzw. der Bediener oder die Bedienerin sollte mit dem Bezirk vertraut sein und Hindernisse kennen, die zugewachsen und dadurch nicht erkennbar sein können (z. B. Böschungstreppen, Wassereinläufe oder Grenzsteine). Gleiches gilt für bewachsene Flächen, die als "wilde Müllkippen" genutzt werden, z. B. Randstreifen im Bereich von Parkplätzen oder Auf- und Abfahrten. Erkennbare gefahrbringende Fremdkörper werden entfernt.
- Bei Mähgeräten mit Schlegelwellen werden diese erst dann eingeschaltet, wenn das Arbeitsgerät am Boden aufliegt und sich keine Person im Gefahrbereich aufhält.
- Die Gefahrbereiche gemäß Herstellerangaben werden beachtet. Die Arbeit wird unterbrochen wenn Personen in den Gefahrbereich gelangen (Anhalten des Arbeitsfahrzeugs und Abschalten des Arbeitsgerätes).
- Die Seitenfenster des Trägerfahrzeugs werden geschlossen gehalten, damit evtl. hochgeschleuderte Gegenstände nicht in die Fahrerkabine eindringen können.
- Die Kombination von mehreren gleichzeitig an Auslegern betriebenen Geräten kann den Einsatz einer zweiten Person zur Bedienung erforderlich machen.
- Bei Arbeiten im öffentlichen Verkehrsraum ist die Arbeitsstelle nach RSA und ASR A5.2 zu sichern. Dabei werden die Sicherungsmaßnahmen den örtlichen Bedingungen (z. B. Übersichtlichkeit der Strecke, Einmündungen im Streckenverlauf) entsprechend angepasst. Siehe auch Kapitel 3.3.
- Alle Arbeiten an den Arbeitsgeräten (z. B. Rüstarbeiten, Störungsbeseitigung, Anbringen von Transportsicherungen) werden nur im gefahrlosen Zustand durchgeführt. Siehe Kapitel 3.5.
- Beachten Sie bei An- und Abbau von Auslegern und Anbaugeräten die Montagehinweise in den Betriebsanleitungen der Hersteller.
- Stellen Sie bei Schnittarbeiten in der Nähe elektrischer Freileitungen sicher, dass zwischen dem höchsten Teil des Auslegers bzw. des Anbaugerätes und den Leitungen ein Sicherheitsabstand von mindestens 5 m eingehalten wird.
|
3.7.4 Arbeiten an Hängen
Das Arbeiten an Hängen stellt – in Abhängigkeit von der Steigung und der Beschaffenheit – immer eine besondere Gefährdung und Belastung dar. Die Beschäftigten selber können abrutschen oder abstürzen, aber auch die eingesetzten Arbeitsgeräte können ab- oder umkippen und dabei die Bediener oder die Bedienerin verletzen. Deshalb ist der Einsatz geeigneter Verfahren und Geräte erforderlich. Durch die Verwendung ferngesteuerter Geräte ist es nicht mehr notwendig, den Hang zu betreten.
In der Regel sind Hänge natürlichen Ursprungs. Aber auch im Rahmen von Baumaßnahmen können Hänge bzw. Böschungen entstehen. Auf deren Neigung und Nutzung kann bei der Planung Einfluss genommen werden.

|
Weitere Informationen
|
- SVLFG Broschüre B30 "Grünpflege im Gartenbau"
- Betriebsanleitungen der Gerätehersteller
|
|
Gefährdungen
|
- Aus- oder Abrutschen beim Gehen oder Arbeiten am Hang
- Handgeführte Maschinen können abrutschen oder umkippen. Dadurch ist der Maschinenführer gefährdet. Durch abrutschende oder umkippende Maschinen (z. B. handgeführte, selbstfahrende oder ferngesteuerte Mäher) können unterhalb befindliche Beschäftigte getroffen werden.
- Gefährdungen durch Fehlsteuerung von ferngesteuerten Maschinen
- Füße können beim Aus- oder Abrutschen in das Mähwerk geraten.
- Beim Umkippen von Aufsitzmähern oder Schleppern können die Bedienpersonen durch Abspringen oder Herausschleudern von der kippenden Maschine verletzt werden.
|
|
Maßnahmen
|
|
Stellen Sie sicher, dass, abhängig von der Gefährdungsbeurteilung, gegen diese und weitere mögliche Gefährdungen folgende Maßnahmen getroffen werden:
- Bei der Neuanlage von geneigten Park- und Gartenflächen oder Böschungen, die regelmäßig betreten werden müssen, wird die Neigung auf 30 % (ca. 17°) begrenzt.
- Vor dem Einsatz wird die vorhandene maximale Hangneigung des Geländes ermittelt. Danach richtet sich, welche Arbeitsmittel zum Einsatz kommen.
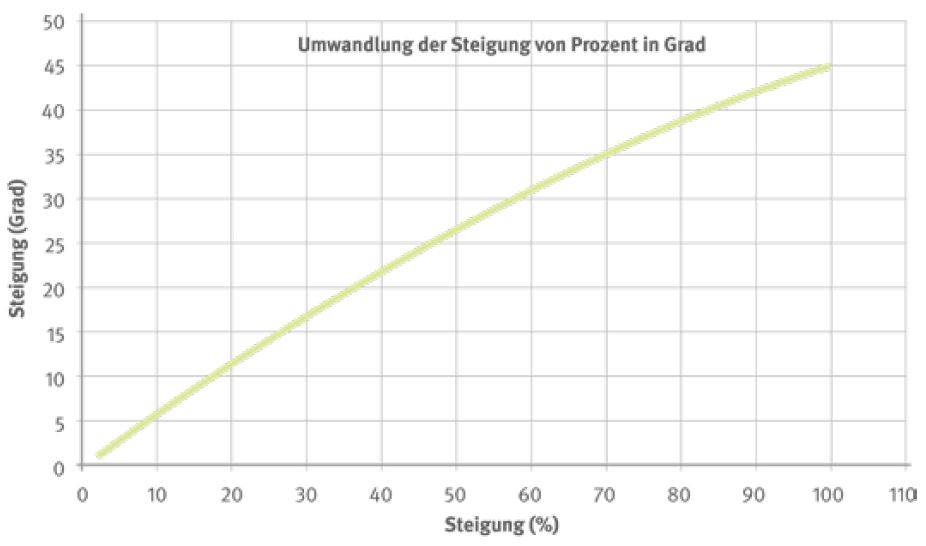
Abb. 50 Umrechnungshilfe für Hangneigung
Tipp:
Installieren Sie eine geeignete App zur Ermittlung der Hangneigung auf Ihrem Smartphone. |
| Weder bei handgeführten noch bei ferngesteuerten Mähgeräten halten sich Beschäftigte unterhalb der Geräte auf. |
Fehlbedienungen beim Einsatz von ferngesteuerten Geräten führen häufig zu Unfällen.
Einerseits ist es schwer, sich je nach Positionierung zum Gerät in die ausgelösten Bewegungsabläufe hinein zu denken und andererseits ist auf die vorgesehene Handhabung der Fernsteuerung zu achten. Hierzu gehört die richtige Trageweise des Handsenders |
|
3.7.5 Freischneidearbeiten
Freischneider sind aufgrund ihrer vielfältigen Einsatzmöglichkeiten aus der Grün- und Landschaftspflege nicht mehr wegzudenken. Insbesondere für kleine, schwer zugängliche Flächen werden Freischneider eingesetzt. Die mit hoher Geschwindigkeit rotierenden Werkzeuge stellen jedoch eine immer wieder unterschätzte Gefahr dar. Verletzungen an Augen und Beinen durch hochgeschleuderte Fremdkörper, insbesondere bei Nichtbeachtung der Gefahrenbereiche und Sicherheitsabstände sind regelmäßig die Folge.

|
Weitere Informationen
|
- DGUV Information 214-046 "Sichere Waldarbeiten"
- SVLFG Broschüre B30 "Grünpflege im Gartenbau"
- Betriebsanleitungen der Hersteller der Freischneider
|
|
Gefährdungen
|
|
Bei Freischneidearbeiten können folgende Gefährdungen auftreten:
- Schwere Verletzungen bei Kontakt mit den rotierenden Werkzeugen.
- Augen- und Gesichtsverletzungen durch hochgeschleuderte Fremdkörper.
- Gesundheitsschäden durch Kraftstoffe und Abgase.
- Gehörschädigung durch Lärm.
Verletzungen werden häufig durch nicht bestimmungsgemäße Nutzung verursacht, wie z. B.
- Aufenthalt von Personen im Gefahrenbereich
- Fehlende oder ungeeignete Werkzeugabdeckung
- Einsatz ungeeigneter oder beschädigter Werkzeuge
- Fehlende, ungeeignete oder mangelhafte Persönliche Schutzausrüstung
|
- Gesundheitsschäden durch Hand-Arm-Vibrationen.
- Muskel-Skelett-Erkrankungen durch falsche Einstellung von Handgriffen und Tragegurt.
|
|
Maßnahmen
|
|
Stellen Sie sicher, dass bei Freischneiderarbeiten, abhängig von der Gefährdungsbeurteilung, gegen diese und weitere mögliche Gefährdungen folgende Maßnahmen getroffen werden:
- Vor Arbeitsbeginn sind die Tragegurte und Griffe entsprechend der Körpergröße einzustellen.
- Freischneidegeräte dürfen nur gestartet werden, wenn das Schneidwerkzeug keine Berührung mit anderen Gegenständen, wie z. B. dem Erdboden, Steinen, Ästen und dergleichen hat.
- Vor Arbeitsbeginn ist der einwandfreie Zustand der Werkzeuge und der dazugehörigen Schutzeinrichtungen zu überprüfen.
- Beschädigte Werkzeuge oder Schutzeinrichtungen müssen sofort ausgetauscht werden.
| Metallschneidwerkzeuge nach jeder Berührung mit harten Gegenständen (z. B. Steine, Felsbrocken, Metallteilen) auf Anrisse und Verformungen prüfen! |
- Vor Arbeitsbeginn ist ein geeignetes und zugelassenes Werkzeug auszuwählen.
- Die Schutzeinrichtung ist entsprechend dem verwendeten Werkzeug auszuwählen.
- Der vom Hersteller vorgegebene Gefahrenbereich ist einzuhalten.
Vor jedem Einsatz überprüfen:
- Fester Sitz des Schneidwerkzeuges
- Schärfe des Schneidwerkzeuges (beim Schärfen Unwucht vermeiden)
- Gashebelrückstellung
- Stillstand des Schneidwerkzeuges bei Leerlauf
|
- Schutz gegen gesundheitsgefährliche Stoffe
Beim Betrieb von Freischneidern mit Verbrennungsmotor werden gesundheitsgefährliche Stoffe freigesetzt. Deshalb prüfen Sie, ob der Einsatz von Akku-Geräten möglich ist. Anderenfalls sorgen Sie dafür, dass
- Freischneider mit schadstoffarmen Motoren verwendet werden,
- Luftfilter sauber gehalten werden,
- eine ordnungsgemäße Wartung und Motoreinstellung nach Herstellerangaben erfolgt,
- Sonderkraftstoffe eingesetzt werden,
- die Freischneider nicht unnötig laufen gelassen werden und
- Abgase frei abziehen können.
Kein Einsatz von herkömmlichen Ottokraftstoffen!
Nach der Gefahrstoffverordnung sind Gefahrstoffe durch Zubereitungen oder Erzeugnisse zu ersetzen, die für die Gesundheit und Sicherheit der Beschäftigten nicht oder weniger gefährlich sind. Herkömmliche Ottokraftstoffe enthalten Benzol. Freischneider dürfen deshalb nur mit benzolfreien Sonderkraftstoffen (z. B. Alkylatbenzin) betrieben werden. |
Werkzeugauswahl
Bitte beachten Sie, dass auf dem Markt Werkzeuge erhältlich sind, die nicht immer sicherheitstechnisch empfehlenswert sind. Achten Sie auch auf die Angaben der Hersteller in Bezug auf zu verwendende Werkzeuge!
Im Handel sind spezielle normgerechte und geprüfte Werkzeuge erhältlich, bei denen sich durch ihre Arbeitsweise der Gefahrenbereich deutlich reduzieren lässt. (s. Abb. 58–61)
| 
Abb. 58 Luftkissenprinzip und spezielle Schutzhaube
|

|

|

|
Abb. 59 Graschneideblatt mit
Kanten- und Rindenschutz |
Abb. 60 Zweischeibenschneidwerk
(Rotationsprinzip) |
Abb. 61 Zweischeibenschneidwerk
(Scherenprinzip) |
|
 Persönliche Schutzausrüstungen Persönliche Schutzausrüstungen
Sorgen Sie dafür, dass die umfangreiche persönliche Schutzausrüstung zur Verfügung steht, sich in einem einwandfreien Zustand befindet und vollständig getragen wird. Diese besteht bei Arbeiten mit dem Freischneider aus:
- Augen- und Gesichtsschutz (s. Abb. 62)
- Gehörschutz
- Schutzhandschuhe
- Sicherheitsschuhe
- gegebenenfalls Wetterschutzkleidung
- gegebenenfalls Warnkleidung (bei Arbeiten im Verkehrsraum)

Abb. 62 Geeignete Gehör-, Augen- und Gesichtsschutzkombination
Darüberhinaus haben sich Hosen mit Prallschutzeigenschaft/Prallschutzhosen zum Schutz der Beine bewährt.
| Gesichtsschutzschirme mit Drahtgewebe haben keine ausreichende Schutzwirkung gegen weggeschleuderte Fremdkörper! Als Augenschutz ist daher zusätzlich zum Gesichtsschutz immer eine enganliegende Schutzbrille erforderlich! |
|
3.7.6 Hecken- und Strauchschnittarbeiten
Beim Hecken- und Strauchschnitt kommen Heckenscheren mit Elektro- oder Verbrennungsmotor zum Einsatz. Die Arbeiten werden sowohl vom Erdboden aus, als auch von Arbeitsgerüsten und Hubarbeitsbühnen aus durchgeführt. Bei Fehlbedienung, Manipulationen oder Entfernen von Schutz- und Sicherheitseinrichtungen können Schnittverletzungen durch das Schnittwerkzeug, insbesondere an Händen und Oberschenkeln, die Folge sein. Ungeeignete Aufstiegsmittel können zum Teil schwere Absturzunfälle zur Folge haben. Mängel an der Zuleitung oder dem Anschlusskabel und fehlende Absicherung über Personenschutzschalter können zu gefährlichen Stromunfällen führen. Zudem kann die zum Teil hohe Lärmbelastung dieser Geräte langfristig Gehörschäden verursachen.

|
Weitere Informationen
|
- VSG 3.1 "Technische Arbeitsmittel" § 70
- Betriebsanleitungen der Hersteller
- SVLFG Broschüre B30 "Grünpflege im Gartenbau"
|
|
Gefährdungen
|
|
Beim Hecken- und Strauchschnitt können folgende Gefährdungen auftreten:
- Schnittverletzungen durch das Schnittwerkzeug (insbesondere an Händen und Beinen)
- Verletzungen durch Absturz bei Verwendung ungeeigneter Aufstiegshilfen (insbesondere bei unzulässiger Arbeit auf der Leiter)
- Verletzungen durch Stromwirkung (Stromschlag)
- Verletzungen durch nachlaufende Arbeitswerkzeuge, z. B. bei Störungsbeseitigung
- Gehörschädigung durch Lärm
- Stichverletzungen bei Arbeit an dornigen Hecken und Sträuchern
- Augenverletzungen durch frische Schnittstellen an Ästen oder Zweigen
- Verletzungen durch zurückschnellende Zweige
|
|
Maßnahmen
|
|
Stellen Sie sicher, dass, abhängig von der Gefährdungsbeurteilung, gegen diese und weitere mögliche Gefährdungen folgende Maßnahmen getroffen werden:
| Beachten Sie zunächst die allgemeinen Hinweise in Kapitel 3.4! |
Auswahl und sicherer Zustand der Maschine
Betrieb der Maschine
- Die Arbeitskleidung der Bedienpersonen ist eng anliegend, Schutzhandschuhe haben Bündchen. Die Bedienperson trägt keinen Schmuck, der eine Gefährdung darstellt (z. B. Ringe, Armbänder).
- Bedienpersonen mit langen Haaren tragen diese nicht offen oder schützen diese durch Tragen einer geeigneten Kopfbedeckung.
- Es wird von sicheren Standplätzen aus gearbeitet. Dies sind z. B. Arbeitsgerüste oder Hubarbeitsbühnen. Leitern sind nicht geeignet, da Heckenscheren ein beidhändiges Führen und Bedienen erfordern und dadurch kein sicherer Stand gewährleistet ist. Eine Alternative kann der Einsatz einer Teleskopheckenschere sein. (s. Abb. 65 und 66)
- Während des Betriebes der Heckenschere wird kein Schnittgut mit den Händen entfernt (z. B. auf der Heckenkrone).
- Beim Standortwechsel wird die Heckenschere nur mit stillstehender Schneidvorrichtung getragen.
- Beim Transport wird die Heckenschere nur an den vorgesehenen Griffen getragen.

|

|
Abb. 65 Teleskopheckenschere beim seitlichen Schnitt |
Abb. 66 Teleskopheckenschere beim Dachschnitt |
 Persönliche Schutzausrüstungen Persönliche Schutzausrüstungen
Sorgen Sie dafür, dass die erforderliche persönliche Schutzausrüstung gemäß der Angaben aus der Bedienungsanleitung des Herstellers zur Verfügung steht, sich in einem einwandfreien Zustand befindet und vollständig getragen wird. Dieses können folgende Schutzausrüstungen sein:
- Gehörschutz
- Augenschutz/Gesichtsschutz
- Schutzhandschuhe mit Bündchen
- Sicherheitsschuhe
- Wetterschutzkleidung
- gegebenenfalls Warnkleidung (bei Arbeiten im Verkehrsraum)

|

|
Abb. 67 Ergonomisch vorteilhaft: Heckenschere mit rückentragbarem Akku |
Abb. 68 Hosen mit Schnittschutzprotektoren für den Heckenschnitt |
|
3.7.7 Arbeiten mit Laubblas- und Laubsauggeräten
Besonders im Herbst, wenn das herabgefallene Laub der Bäume und Sträucher entfernt und abtransportiert werden muss, sind Laubblas- und Laubsauggeräte weit verbreitet. Aber auch zum Reinigen von Straßen, Wegen und Plätzen werden sie regelmäßig eingesetzt. Bei unsachgemäßer Anwendung stellen sie jedoch ein nicht zu unterschätzendes Risiko dar. Wegfliegende Fremdkörper können Personen verletzen oder Sachschäden verursachen, die umlaufende Turbine kann zu schweren Verletzungen führen. Weiterhin sind nicht unerhebliche Gefahren durch Vibrationen, Lärm und Abgase vorhanden.

|
Weitere Informationen
|
- SVLFG Broschüre B30 "Grünpflege im Gartenbau"
- Betriebsanleitungen der Hersteller
|
|
Gefährdungen
|
|
Beim Umgang mit Laubblas- und Laubsauggeräten treten häufig folgende Gefährdungen auf:
- Verletzungsgefahr durch wegfliegende Fremdkörper (Steine, Glasscherben, Metallteile, …)
- Infektionsgefahr durch aufgewirbelte Krankheitserreger in Tierkot
- Verletzungsgefahr durch unzureichend gesicherte Gefahrstellen an der Turbine oder am Motor wegen defekter Schutzeinrichtung
- Verbrennungsgefahr am Auspuff
- Gesundheitliche Belastungen durch Vibrationen, Lärm, Abgase, organische Stäube
Wegen des Umgangs mit organischem Material beim Laubblasen und -saugen zählen Tätigkeiten in diesem Bereich zu den nicht gezielten Tätigkeiten mit biologischen Arbeitsstoffen im Sinne der Biostoffverordnung. Mit dem verrottenden Laub und dem Straßenstaub können auch Fäkalien von Tieren wie Hunde- oder Taubenkot mit aufgewirbelt bzw. aufgesaugt werden. Allergene (Schimmelpilze) und Krankheitserreger können dabei in die Atemluft gelangen.
|
|
Maßnahmen
|
|
Stellen Sie sicher, dass, abhängig von der Gefährdungsbeurteilung, gegen diese und weitere mögliche Gefährdungen folgende Maßnahmen getroffen werden:
- Vor Arbeitsbeginn wird eine Sicht- und Funktionsprüfung durchgeführt.
- Es sind alle Schutzeinrichtungen montiert und wirksam.
- Es wird darauf geachtet, dass weder Füße, Hände, lange Haare noch Schmuck oder Kleidungsstücke in den Lufteinlass gezogen werden können.
- Bei der Benutzung von Blasgeräten wird ein ausreichender Sicherheitsabstand zu Personen eingehalten (Herstellerangaben werden beachtet).
- Es werden immer sichere, rutschfeste Schuhe, und lange Hosen getragen.
- Die Beseitigung von Verstopfungen darf nur bei ausgeschaltetem Motor und Stillstand der Turbine erfolgen.
- Laubblas- und Laubsauggeräte mit Akkubetrieb sind zu bevorzugen.
Schutz gegen gesundheitsgefährliche Stoffe und Hand-Arm-Vibrationen
Beachten Sie hinsichtlich der Vermeidung von Gesundheitsgefahren durch Abgase und Hand-Arm-Vibrationen die Hinweise zu motorisch angetriebenen Geräten in Kapitel 3.4. |
Beachten Sie auch die örtlichen Bestimmungen bezüglich der Geräuschpegel und Betriebszeiten von Laubblasgeräten.
 Persönliche Schutzausrüstungen Persönliche Schutzausrüstungen
Bei Arbeiten mit Laubblas- oder Laubsauggeräten ist geeigneter Körperschutz, bestehend mindestens aus Augenschutz, Gehörschutz und Schutzhandschuhen zu tragen. Wenn das Gerät in staubiger und/oder biostoffbelasteter Umgebung benutzt wird, ist zusätzlich eine Atemschutzmaske erforderlich.
|
3.8 Baumarbeiten
3.8.1 Baumschnittarbeiten
Zu den typischen Baumschnittarbeiten gehören alle Pflege- und Sägearbeiten am stehenden Stamm und in der Baumkrone. In der Praxis kommt es immer wieder zu schweren Unfällen durch herabfallende Ast- oder Stammteile. Schützen Sie die Sicherheit und Gesundheit Ihrer Beschäftigten durch Auswahl der richtigen Werkzeuge und das Umsetzen von Aufenthaltsverboten im Gefahrenbereich. In besonderen Situationen sind spezielle Schnitt- und Abseiltechniken erforderlich, die eine umfangreiche Ausbildung und Erfahrung der Beschäftigten erfordern.

|
Weitere Informationen
|
- SVLFG Unfallverhütungsvorschrift VSG 4.2 "Gartenbau, Obstbau und Parkanlagen”
- SVLFG Broschüre B08 "Baumarbeiten"
- Betriebsanleitungen der Hersteller
|
|
Gefährdungen
|
|
Bei Baumschnittarbeiten treten häufig folgende Gefährdungen auf:
- Schnittverletzungen durch scharfe und spitze Werkzeuge und Maschinenteile,
- Getroffen werden durch herabfallende Äste und Stammteile,
- Stolpern, Ausrutschen oder Stürzen durch unsichere Standplätze,
- Abstürzen bei Arbeiten von erhöhten Standplätzen,
- Gefährdungen durch Lärm, Vibrationen und Abgase bei verbrennungsmotorisch angetriebenen Maschinen wie Motorsägen und Hochentastern,
- Erkrankungen des Muskel-Skelett-Systems durch Zwangshaltung.
|
|
Maßnahmen
|
|
Stellen Sie sicher, dass, abhängig von der Gefährdungsbeurteilung, gegen diese und weitere mögliche Gefährdungen folgende Maßnahmen getroffen werden:
Auswahl der geeigneten Werkzeuge
Stellen Sie die für die jeweilige Arbeitsaufgabe erforderlichen Werkzeuge und Maschinen zur Verfügung. Es muss nicht immer die Motorsäge sein! Handsägen, Teleskopsägen und Astscheren in vielen Ausführungen stehen für Baumschnittarbeiten zur Verfügung.

Abb. 71 Handwerkzeuge für Baumschnittarbeiten
Freihalten von Gefahrenbereichen
Stellen Sie sicher, dass sich im Fallbereich von Ästen und Stammteilen nur die mit dem Schneidevorgang beschäftigten Personen aufhalten. Da fallende Äste beim Aufschlagen auf den Boden hochschlagen können, ist ein ausreichend großer Fallbereich freizuhalten (vgl. Abbildung 72).
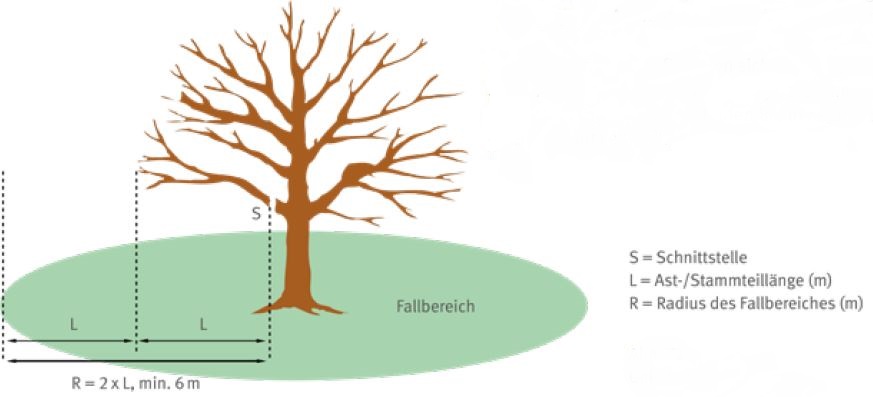
Abb. 72 Gefahrenbereich
Wahl sicherer Standplätze
Sorgen Sie dafür, dass Baumschnittarbeiten nur von sicheren Standplätzen aus durchgeführt werden. Bei Standplätzen über 2,00 m Höhe sind Sicherungen gegen Absturz zu verwenden. Als sichere Standplätze gelten:
- der Erdboden, wenn keine Rutschgefahr besteht,
- Spezialleitern für den Einsatz am Baum, sofern nur Arbeiten geringen Umfangs durchgeführt werden und keine motorisch angetriebene Geräte eingesetzt werden,
- Arbeitskörbe, z. B. von Hubarbeitsbühnen,
- Gerüste,
- mechanische Leitern mit umwehrter Plattform,
- gesunde und ausreichend tragfähige Äste, wenn in der Seilklettertechnik ausgebildete Beschäftigte geeignete und geprüfte Ausrüstung gegen Absturz einsetzen.
Spezialleitern sorgen für einen sicheren Stand. Von ihnen aus sind Arbeiten geringen Umfangs, z. B. mit Handsägen, möglich. Nähere Hinweise finden Sie in Kapitel 3.9.3 "Arbeiten auf Leitern".
Anwendung spezieller Schnitt- und Abseiltechniken
Baumschnittarbeiten werden häufig im Bereich des öffentlichen Straßenverkehrs oder unter beengten Verhältnissen, z. B. in Parkanlagen oder auf bebauten Grundstücken, durchgeführt. Ast- und Stammteile müssen dann so geschnitten und zu Boden gebracht werden, dass keine Schäden an Gebäuden, Freileitungen usw. entstehen. Hierfür sind oft spezielle Schnitt- und Abseiltechniken notwendig, die eine umfangreiche Ausbildung und Erfahrung voraussetzen.
Stufenschnitt
Der Stufenschnitt wird für waagerechte, nicht kopflastige Äste eingesetzt. Das Aststück fällt kontrolliert ohne Abzukippen nach unten.
Kerbschnitt
Bei stark kopflastigen Ästen findet der Kerbschnitt seine Anwendung. Mit Hilfe dieser Schnitttechnik ist ein kontrolliert geführtes Abkippen von Ästen möglich. Fallkerb und Bruchleiste geben dem Aststück Führung, bis sich der Kerb schließt.
Gegenschnitt
Zum kontrollierten Abnehmen und Abwerfen von Aststücken wird der Gegenschnitt eingesetzt.
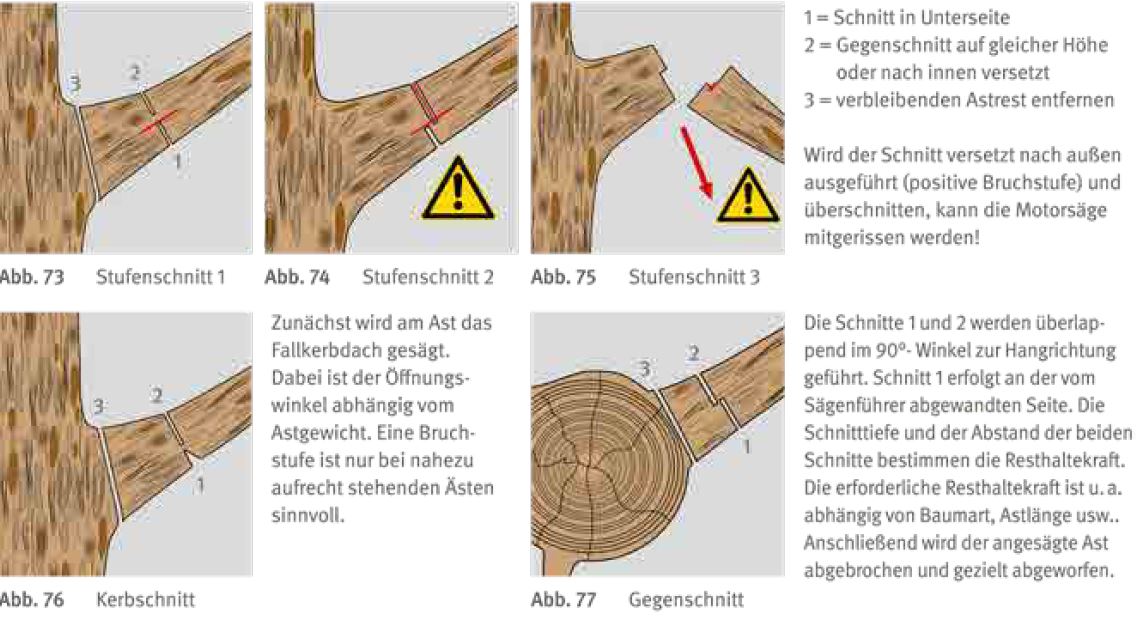
Arbeiten mit Zwangshaltung (z. B. Überkopfarbeiten) sind zeitlich zu begrenzen.
Abseiltechnik
Abseiltechniken kommen dann zum Einsatz, wenn Äste und Stammteile nicht frei fallen dürfen oder "handliche Stücke" für kontrolliertes Abwerfen nicht möglich sind. Dazu sind zum Beispiel Kenntnisse über Knotentechnik, Umlenkrollen, Seilbremsen usw. notwendig. Diese Arbeiten erfordern ein erfahrenes Team mit spezieller Ausbildung, genaue Absprachen und gute Kommunikation (z. B. durch Einsatz von Helmfunk).
 Persönliche Schutzausrüstungen Persönliche Schutzausrüstungen
Stellen Sie Ihren Beschäftigten die im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung ermittelte und festgelegte persönliche Schutzausrüstung zur Verfügung und sorgen Sie dafür, dass diese getragen wird. Bei Baumschnittarbeiten sind in der Regel stets erforderlich:
- Kopfschutz,
- Schutzhandschuhe und
- Sicherheitsschuhe.
Je nach Arbeitsort und eingesetzten Maschinen bzw. Geräten können darüber hinaus folgende persönliche Schutzausrüstungen notwendig sein:
- Gehörschutz,
- Augen- bzw. Gesichtsschutz,
- Schnittschutzhose und Schnittschutzstiefel,
- Warnkleidung.
|
3.8.2 Arbeiten mit Motorsägen
Motorsägen sind heute ein unverzichtbares Arbeitsmittel bei Baumarbeiten. Ihr Einsatz ist jedoch mit einer Vielzahl von Gefährdungen verbunden. Die Arbeit mit Motorsägen gilt als "gefährliche Arbeit" und erfordert zur Verhütung von Unfällen und Gesundheitsgefahren ein umfassendes und abgestimmtes Paket von Schutzmaßnahmen. Die technischen Sicherheitseinrichtungen können auch an modernen Motorsägen nur begrenzten Schutz bieten. Deshalb haben sowohl eine fundierte Ausbildung des Motorsägenführers oder der Motorsägenführerin als auch die Auswahl der richtigen Säge für den jeweiligen Einsatzzweck und die persönliche Schutzausrüstung eine große Bedeutung.

|
Weitere Informationen
|
- DGUV Information 214-046 "Sichere Waldarbeiten"
- DGUV Information 214-059 "Ausbildung für Arbeiten mit der Motorsäge und die Durchführung von Baumarbeiten"
- SVLFG Broschüre B08 "Baumarbeiten"
- Betriebsanleitungen der Hersteller der Motorsägen
|
|
Gefährdungen
|
|
Bei Arbeiten mit Motorsägen treten häufig folgende Gefährdungen auf:
- Aufenthalt von Personen im Gefahrenbereich
- Führen der Motorsäge mit einer Hand
- Sägearbeiten über Kopf
- Sägearbeiten auf unsicheren Standplätzen
- Verletzungen durch Rückschlag der Säge, z. B. bei unsachgemäßem Arbeiten mit der Schienenspitze oder auch das unsachgemäße bodennahe Abschneiden von Ästen mit der auslaufenden Kette
- Augen- oder Gesichtsverletzungen durch weggeschleuderte Späne oder Splitter
- Gesundheitsschäden durch Kraftstoffe und Abgase
- Gehörschädigung durch Lärm
- Gesundheitsschäden durch Hand-Arm-Vibrationen
|
|
Maßnahmen
|
|
Stellen Sie sicher, dass, abhängig von der Gefährdungsbeurteilung, gegen diese und weitere mögliche Gefährdungen folgende Maßnahmen getroffen werden:
Ausbildung
Die Motorsägenführer oder Motorsägenführerinnen müssen für die Arbeiten ausgebildet sein und ihre Befähigung nachgewiesen haben. Je nach Arbeitsaufgabe können verschiedene Ausbildungsmodule erforderlich sein (siehe DGUV Information 214-059).
Auswahl der Säge
Die für die jeweilige Aufgabe geeignete Motorsäge sollte zur Verfügung stehen und eingesetzt werden. Für den professionellen Einsatz stehen aus einer umfangreichen Modellpalette verschiedener Hersteller zahlreiche für den jeweiligen Einsatzzweck geeignete Maschinen zur Verfügung. Das Angebot reicht von speziellen "Baumpflegesägen" für den Einsatz in der Baumkrone bis hin zur schweren Fällsäge. Der Einsatz von elektrisch angetriebenen Maschinen mit Akkubetrieb reduziert den Lärmpegel, das zu haltende Maschinengewicht und es entfällt die Abgasbelastung. Motorsägen mit zusätzlichen Sicherheitseinrichtungen wie "QuickStop" oder "TrioBrake" erhöhen die Sicherheit.
|

Abb. 79 Motorsägen für verschiedene Einsatzzwecke
Sicherer Betrieb der Motorsäge
Sorgen Sie dafür, dass die Motorsäge bestimmungsgemäß und unter Beachtung der Sicherheitshinweise eingesetzt wird. Warten und reinigen Sie die Säge regelmäßig gemäß den Angaben in der Betriebsanleitung.
Schutz gegen gesundheitsgefährliche Stoffe
Beim Betrieb von Motorsägen mit Verbrennungsmotor werden gesundheitsgefährliche Stoffe freigesetzt. Sorgen Sie deshalb dafür, dass
- schadstoffarme Motorsägen verwendet werden,
- Luftfilter sauber gehalten werden,
- eine ordnungsgemäße Wartung und Motoreinstellung nach Herstellerangaben erfolgt,
- Sonderkraftstoffe eingesetzt werden,
- die Sägen nicht unnötig laufen gelassen werden und
- Abgase frei abziehen können.
Schutz gegen Gesundheitsgefährdung durch Hand-Arm-Vibrationen
- Achten Sie bereits bei der Beschaffung auf niedrige Vibrationskennwerte der Motorsäge. Akku-Geräte sind vergleichsweise vibrationsärmer als solche mit Verbrennungsmotor.
- Der Zustand der Antivibrationselemente beeinflusst das Vibrationsverhalten. Sorgen Sie im Rahmen der regelmäßigen Prüfung und Wartung für rechtzeitigen Austausch der Antivibrationselemente nach Herstellervorgabe.
- Motorsägen mit Griffheizung reduzieren bei niedrigen Außentemperaturen die Gesundheitsgefährdung.
 Gefährliche Arbeiten
Gefährliche Arbeiten
Keine Alleinarbeit!
Arbeiten mit der Motorsäge gelten als gefährliche Arbeiten. Bei einem Unfall muss unverzüglich Erste Hilfe geleistet und eine erforderliche ärztliche Versorgung veranlasst werden können. Daher ist Alleinarbeit mit der Motorsäge ohne ständige Ruf-, Sicht- oder sonstige Verbindung mit einer anderen Person nicht zulässig.
Betanken nur mit Sicherheits-Einfüllstutzen
Der Sicherheits-Einfüllstutzen öffnet erst im Motorsägentank und schließt automatisch beim Erreichen der Tankfüllmenge.
Daher kein Überfüllen und Verschütten von Kraftstoffen.

|
Sicherheitshinweise beim Betrieb von Motorsägen
Vor Arbeitsbeginn täglich überprüfen:
- Funktionsfähigkeit von Gashebelsperre und Kettenbremse,
- Schärfe der Kette,
- Spannung und Zustand der Kette; defekte Ketten sofort austauschen,
- Leerlaufeinstellung; die Kette muss bei Leerlaufdrehzahl des Motors zum Stillstand kommen,
- Luftfilter
Vor dem Starten die Kettenbremse einlegen.
Bei Arbeitsunterbrechung die Kettenbremse einlegen und den Motor ausschalten.
Nur mit der Motorsäge arbeiten, wenn sich keine Person im Gefahrenbereich aufhält.
Die Säge ist mit beiden Händen fest und sicher zu halten. Dies gilt auch für sogenannte "Top-Handle-Sägen"!
Es ist auf einen sicheren Stand zu achten. Das Arbeiten mit Motorsägen auf Leitern ist nicht zulässig!
Nie über Schulterhöhe sägen!
Den Krallenanschlag benutzen.
Beim Transport den Kettenschutz verwenden.
Das Arbeiten mit der Schienenspitze ist zu vermeiden. Achtung: Rückschlag der Motorsäge!
Beim Ansetzen von Stechschnitten nicht mit der Oberseite der Umlenkung schneiden. |
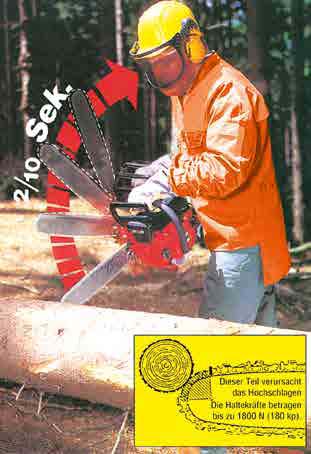
Abb. 81 Achtung Rückschlag |
 Persönliche Schutzausrüstungen
Persönliche Schutzausrüstungen
Sorgen Sie dafür, dass die umfangreiche persönliche Schutzausrüstung zur Verfügung steht, sich in einem einwandfreien Zustand befindet und vollständig getragen wird. Diese besteht bei Arbeiten mit der Motorsäge aus:
- Schutzhelmkombination mit Gehör- und Gesichtsschutz
- Schutzhandschuhe
- Schnittschutzhose
- Sicherheitsschuhe mit Schnittschutzeinlagen
- ggf. Wetterschutzkleidung
- ggf. Warnkleidung (bei Arbeiten im Verkehrsraum)
| Persönliche Schutzausrüstung, insbesondere
Schnittschutz, hat in der Regel nur eine begrenzte
Schutzwirkung. Sie kann fachkundiges und sicheres
Arbeiten nicht ersetzen! |
 Arbeitsmedizinische Maßnahmen
Arbeitsmedizinische Maßnahmen
Lärm
Bei Arbeiten mit Motorsägen mit Verbrennungsmotor ist
die Bedienerperson Schallpegeln von ca. 103 dB(A) bis
115 dB(A) ausgesetzt. Ein Tagesexpositionspegel von
85 dB(A) ist hier schon nach wenigen Minuten erreicht. Dies
kann auch bei Beschäftigten der Fall sein, die in unmittelbarer
Nähe von Motorsägearbeiten tätig sind. Im Rahmen
der Gefährdungsbeurteilung sind Sie verpflichtet den Tagesexpositionspegel
zu ermitteln. Bei einer Überschreitung von
80 dB(A) müssen Sie den Beschäftigten die arbeitsmedizinische
Vorsorge anbieten. Wird der Wert von 85 dB(A) erreicht
oder überschritten, müssen Sie eine Pflichtvorsorge
veranlassen. Diese ist Tätigkeitsvoraussetzung und muss in
regelmäßigen Abständen wiederholt werden.
Hand-Arm-Vibrationen
Trotz der Ausrüstung moderner Motorsägen mit Antivibrationselementen
wirken auf die Bedienperson Hand-Arm-Vibrationen
ein, die bei längerer täglicher Arbeitsdauer
zu Gesundheitsschäden führen können. Sie sind deshalb
verpflichtet, im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung
die Tages-Vibrationsexposition zu ermitteln. Je nach
Motorsäge kann der Auslösewert schon nach wenigen
Stunden erreicht sein. Ist der Auslösewert von 2,5 m/s2
überschritten, so müssen Sie den Beschäftigten eine
arbeitsmedizinische Vorsorge anbieten. Bei Erreichen oder Überschreiten des Expositionsgrenzwertes von
5 m/s2 ist vor Aufnahme der Tätigkeit eine Pflichtvorsorge
zu veranlassen und regelmäßig zu wiederholen.

|

|
Abb. 82 Tragefreundlicher und griffsicherer Textilhandschuh für Motorsägenarbeit |
Abb. 83 Schutzhelmkombination mit Gehör- und Gesichtsschutz und integriertem Helmfunk |

|

|
Abb. 84 Schnittschutzhose mit Schnittschutzeinlage. Bewährt haben sich Hosen, die im Schenkelbereich rundherum Schnittschutz besitzen (Form C). |
Abb. 85 Sicherheitsschuhe mit Zehenkappe, Schnittschutzeinlage und profilierter Sohle |
3.8.3 Arbeiten mit Motorsägen in Arbeitskörben
Wenn Motorsägen in Arbeitskörben eingesetzt werden, kann es – bedingt durch
die Arbeit in der Höhe und durch den eingeschränkten Arbeitsraum – zu besonderen
Gefährdungen kommen. Eine unverzichtbare Schutzmaßnahme ist die spezielle
Ausbildung der Motorsägenführerin oder des Motorsägenführers. Diese
Ausbildung und der Einsatz geeigneter Motorsägen versetzt den Baumpfleger in
die Lage, Äste und Stammteile im Regelfall ohne die Unterstützung durch eine
zweite Person sicher abzutrennen und zu Boden zu bringen. Der Aufenthalt einer
zweiten Person im Arbeitskorb erhöht das Verletzungsrisiko, weil der erforderliche
Sicherheitsabstand nicht eingehalten werden kann.

|
Gefährdungen
|
|
Neben den allgemeinen Gefährdungen bei der Arbeit mit
Motorsägen (siehe Kapitel 3.8.2) oder bei Arbeiten in der
Höhe (siehe Kapitel 3.9) treten beim Einsatz von Motorsägen
in Arbeitskörben u. a. folgende spezielle Gefährdungen auf:
- Schnittverletzungen des Motorsägenführers oder der
Motorsägenführerin durch unzulässiges Sägen über
Schulterhöhe oder unzulässiges Halten der Säge mit
nur einer Hand
- Schnittverletzungen bei weiteren Personen im
Arbeitskorb
- Gefährdungen durch das Zurückschlagen oder Herabfallen
abgesägter Äste oder Stammteile
- Eine besondere Gefährdung kann sich auch aus der
Nähe zu elektrischen Freileitungen ergeben.
|
|
Maßnahmen
|
|
Stellen Sie sicher, dass, abhängig von der Gefährdungsbeurteilung, gegen diese und weitere mögliche Gefährdungen folgende Maßnahmen getroffen werden:
Geeignete Hubarbeitsbühne
Die eingesetzte Hubarbeitsbühne ist für die durchzuführenden Baumarbeiten geeignet. Sie sollte insbesondere so dimensioniert sein, dass alle Schnitte mit der Motorsäge von der Standfläche des Arbeitskorbes aus sicher ausgeführt werden können. Die Umwehrung des Arbeitskorbes ist mit einem leicht zerspanbaren Rand ausgestattet.
 Qualifikation Qualifikation
Der Motorsägenführer oder die Motorsägenführerin ist für die Baumarbeiten mit der Motorsäge in Arbeitskörben von Hubarbeitsbühnen speziell ausgebildet. Die Ausbildung richtet sich beispielsweise nach Modul C bzw. D der DGUV Information 214-059 oder AS Baum II.
Geeignete Motorsäge
Motorsägen mit möglichst geringem Gewicht und kurzer Schiene sind für diese Tätigkeiten zu bevorzugen.
Sogenannte "Top-Handle-Sägen" sind speziell für die Baumpflege konzipierte Motorsägen. Trotz der besonderen Konzeption des Griffsystems müssen auch diese Sägen mit beiden Händen geführt werden!

|
Betrieb
Der Arbeitskorb wird so positioniert, dass nicht über Schulterhöhe gesägt werden muss. Eine unmittelbare Gefährdung durch abgesägte oder zurückschlagende Äste ist zu vermeiden.
Außer der Motorsägenführerin oder dem Motorsägenführer hält sich keine weitere Person im Arbeitskorb auf. Nur in begründeten Ausnahmefällen ist eine zweite Person mit entsprechender Fachkunde im Arbeitskorb zulässig.
Ausnahmefälle können z. B. sein:
- die Durchführung von Ausbildungsmaßnahmen in der Baumpflege,
- der notwendige Einsatz eines Bedieners oder einer Bedienerin für die Hebebühne, z. B. wenn es sich um eine gemietete Hebebühne handelt, die nur mit einem Bediener oder einer Bedienerin zur Verfügung gestellt wird.
 Persönliche Schutzausrüstungen Persönliche Schutzausrüstungen
Der Motorsägenführer bzw. die Motorsägenführerin trägt die grundlegende persönliche Schutzausrüstung gemäß Kapitel 3.8.2.
Hält sich in einem begründeten Ausnahmefall eine zweite Person im Arbeitskorb auf, so muss diese Person neben der grundlegenden Schutzausrüstung für Motorsägenarbeiten folgende zusätzliche persönliche Schutzausrüstung benutzen:
- Schnittschutzjacke mit zusätzlichen Schnittschutzeinlagen im Schulter-, Hals-, Brust- und Bauchbereich.
- Schnittschutzhandschuhe zum Schutz der Hände und Unterarme.
|
|
Weitere Informationen
|
- DGUV Information 203-033 "Ausästarbeiten in der Nähe elektrischer Freileitungen"
- DGUV Information 208-019 "Sicherer Umgang mit fahrbaren Hubarbeitsbühnen"
- DGUV Information 214-059 "Ausbildung für Arbeiten mit der Motorsäge und die Durchführung von Baumarbeiten"
- SVLFG Broschüre B08 "Baumarbeiten"
- Betriebsanleitung des Herstellers der Motorsäge
- Betriebsanleitung des Herstellers der Hubarbeitsbühne
|
3.8.4 Fällen von Bäumen
Jeder Baum ist einzigartig. Sein Wachstum ist u. a. abhängig vom lokalen Klima (Mikroklima) und den jeweiligen Standortfaktoren. Er kann auch durch vielfältige Faktoren geschädigt werden. Schädigungen können hervorgerufen werden durch Bodenverdichtungen, Bodenversiegelungen, Wurzelbeschädigungen durch Bauarbeiten, Streusalz, Verkehr, Baumschädlinge.
Deshalb ist es erforderlich, vor Fällarbeiten den Baum fachkundig zu beurteilen (Baumansprache). Erst danach kann die anzuwendende Fälltechnik festgelegt werden. Eine Fehleinschätzung des Baumes oder eine falsche Fälltechnik kann lebensgefährliche Folgen haben.
In der Grün- und Landschaftspflege werden i.d.R. einzeln stehende Bäume gefällt.

|
Rechtliche Grundlagen
|
- DGUV Regel 114-018 "Waldarbeiten"
|
|
Weitere Informationen
|
- DGUV Information 214-046 "Sichere Waldarbeiten"
- DGUV Information 214-059 "Ausbildung für Arbeiten mit der Motorsäge und die Durchführung von Baumarbeiten"
- DGUV Information 214-060 "Seilarbeit im Forstbetrieb"
- SVLFG Broschüre B08 "Baumarbeiten"
|
|
Gefährdungen
|
|
Bei Baumfällarbeiten treten häufig Gefährdungen auf durch:
- Baumeigenschaften wie z. B. Hang des Baumes, Kronenausbildung, trockene Äste, Faulstellen, abgestorbene Bäume im Umfeld
- Falsch gewählte oder nicht korrekt ausgeführte Fälltechnik
- Sägen während der Baum schon fällt
- Hängen gebliebene Bäume, die nicht fachgerecht zu Fall gebracht werden oder deren Gefahrenbereich nicht abgesperrt wird
- Unsicheren Stand, nicht hindernisfreie Rückweiche
- Aufenthalt von Personen im Gefahrenbereich
- Behinderungen durch Witterungseinflüsse wie z. B. Nebel oder Wind
- Vorbei fließenden Verkehr
|
|
Maßnahmen
|
|
Stellen Sie sicher, dass – abhängig von der Gefährdungsbeurteilung – gegen diese und weitere mögliche Gefährdungen, folgende Maßnahmen getroffen werden:
- Es ist eine fachgerechte Baumbeurteilung durchzuführen.
- Mit Fällarbeiten wird erst begonnen, wenn sichergestellt ist, dass Personen nicht gefährdet werden können.
- Im Fallbereich dürfen sich nur die mit der Fällung des Baumes Beschäftigten aufhalten.
Der Fallbereich eines Baumes ist in der Regel die Kreisfläche mit dem Radius der zweifachen Baumlänge um den zu fällenden Baum. Wenn keine anderen Bäume umgerissen werden können, kann entsprechend der Gefährdungsbeurteilung der Fallbereich angemessen reduziert werden.
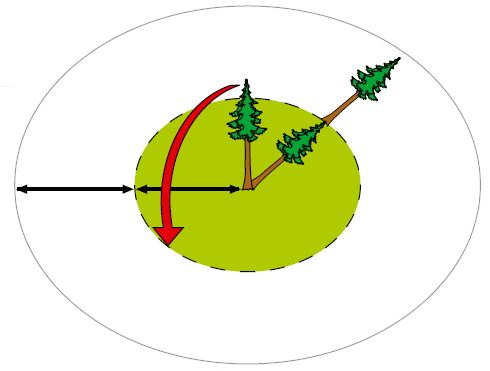
|

Abb. 91 Baumbeurteilung
- Es wird für einen sicheren Stand im Bereich des Arbeitsplatzes gesorgt.
- Mindestens eine sicher begehbare Rückweiche wird fest- bzw. angelegt. Diese soll im Allgemeinen nach schräg rückwärts verlaufen und soweit führen, dass der zuvor festgelegte sichere Standplatz außerhalb der Kronenprojektionsfläche erreicht wird. Störende Äste, Bewuchs und andere Hindernisse werden entfernt, damit die Rückweiche sicher zu begehen ist.
- Bäume werden unter Anwendung einer fachgerechten Fälltechnik zielgerichtet zu Fall gebracht.
- Die Beschäftigten treten in die Rückweiche sobald der Baum zu fallen beginnt. Dabei beobachten sie den Kronenraum.
- Während der Baum fällt, wird nicht mehr gesägt.
- Hängen gebliebene oder angesägte Bäume müssen unverzüglich und fachgerecht zu Fall gebracht werden. Ist das nicht möglich, so ist der Gefahrenbereich abzusperren. Beschäftigte dürfen sich nicht im Gefahrenbereich hängen gebliebener Bäume aufhalten.
- Fällarbeiten werden nur bei ausreichenden Sichtverhältnissen durchgeführt. Bei ungünstigen Windverhältnissen dürfen keine Fällarbeiten vorgenommen werden.
- Im Verkehrsraum sind zum Schutz der Beschäftigten geeignete Baustellenabsicherungsmaßnahmen zu treffen (siehe auch Kapitel 3.3)
 Qualifikation Qualifikation
zum Fällen von Bäumen mit Motorsägen
Eine ausreichende Qualifikation liegt z. B. vor, wenn folgende Ausbildung absolviert wurde:
- Mindestens Module A und B der DGUV Information 214-059
- Lehrgang AS Baum I
- Berufsausbildung, bei der das Fällen von Bäumen mit der Motorsäge Bestandteil des Ausbildungsrahmenplanes ist (z. B. Forstwirt).
 Persönliche Schutzausrüstungen Persönliche Schutzausrüstungen
Siehe Kapitel 3.8.2 "Arbeiten mit Motorsägen"
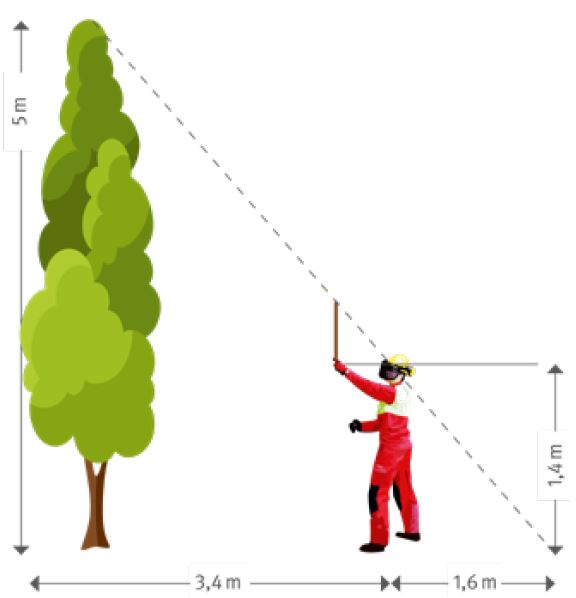
|
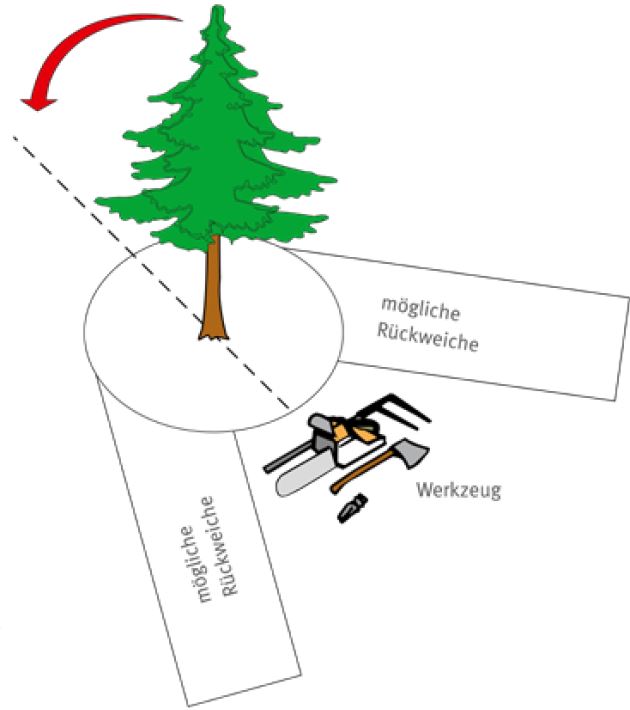
|
Abb. 92 Baumhöhenabschätzung |
Abb. 93 Rückweiche |
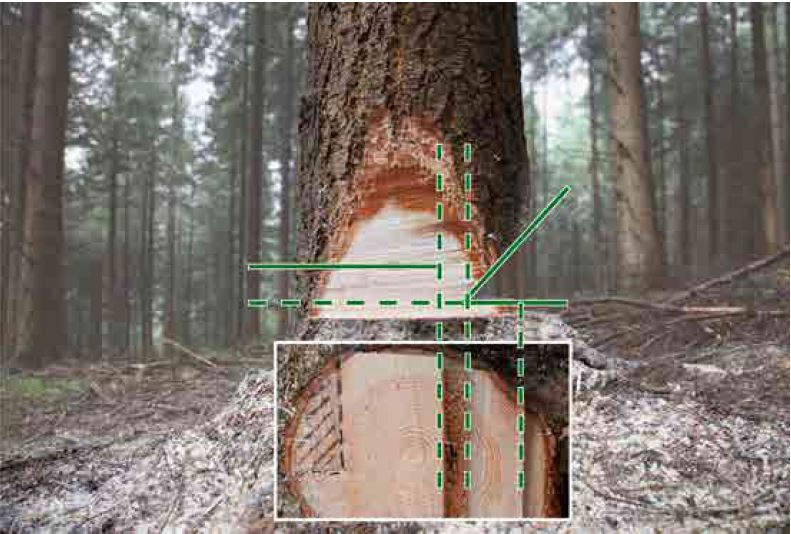
Abb. 94 Fachgerechte Fälltechnik
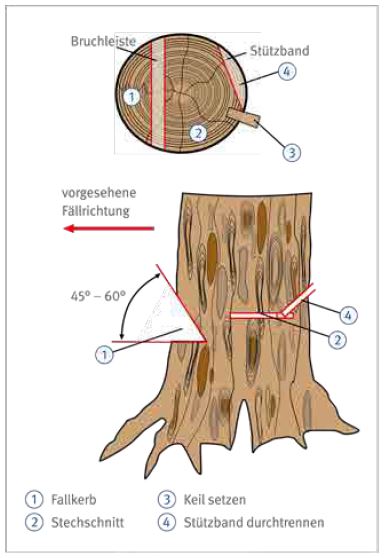
|
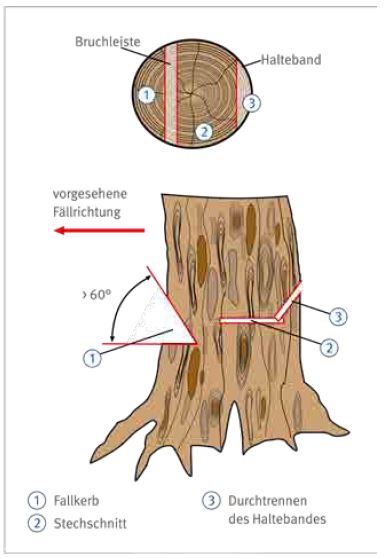
|
Abb. 95 Fällen mit Stützbandtechnik |
Abb. 96 Fällen mit Haltebandtechnik beim Vorhänger |
|
3.8.5 Aufarbeiten von liegendem Holz
Gefällte oder gefallene Bäume müssen entastet und weiter aufgearbeitet werden. Das Entasten ist dabei die unfallträchtigste Teilarbeit.
Die im liegenden Holz vorhandenen Spannungen sind ein hohes Gefahrenpotential, insbesondere wenn es sich um Wind- oder Schneewurf handelt. Arbeiten am geworfenen Holz setzt eine gute Ausbildung und große Erfahrung voraus.

|
Rechtliche Grundlagen
|
- DGUV Regel 114-018 "Waldarbeiten"
|
|
Weitere Informationen
|
- DGUV Information 214-046 "Sichere Waldarbeiten"
- DGUV Information 214-059 "Ausbildung für Arbeiten mit der Motorsäge und die Durchführung von Baumarbeiten"
- SVLFG Broschüre B08 "Baumarbeiten"
|
|
Gefährdungen
|
|
Die im liegenden Holz im Stamm und in den Ästen vorhandenen Spannungen können beim Aufarbeiten zum Aufreißen oder Splittern des Holzes führen oder die Schneidgarnitur einklemmen. Ungewollte Bewegungen des Schnittgutes durch Herumschlagen, Ab- oder Wegrollen usw. können die Motorsägenführerin bzw. den Motorsägenführer oder weitere Personen im Gefahrenbereich gefährden und zu schweren Verletzungen führen.
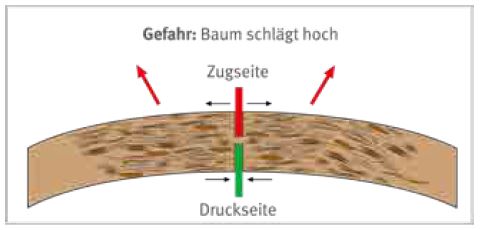
Abb. 98 Stamm auf Oberseite in Zugspannung
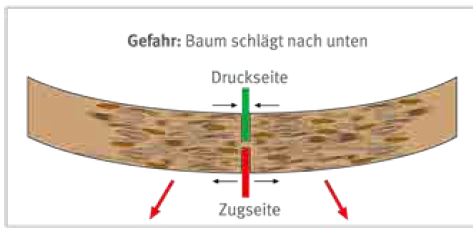
Abb. 99 Stamm auf Unterseite in Zugspannung
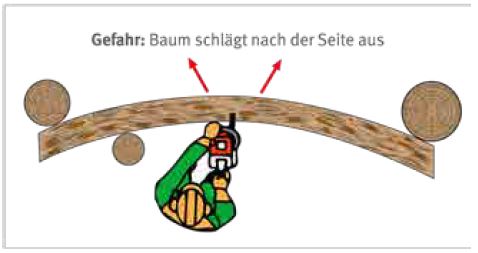
Abb. 100 Stamm seitlich gespannt
|
|
Maßnahmen
|
|
Stellen Sie sicher, dass – abhängig von der Gefährdungsbeurteilung – gegen diese und weitere mögliche Gefährdungen, folgende Maßnahmen getroffen werden:
Bei Aufarbeitung von liegendem Holz in Hanglage:
- In der Regel bergseitig arbeiten.
- Ggf. Stamm sichern (Maschineneinsatz).
Beim Entasten
- Hindernisse beseitigen.
- Eine möglichst leichte Motorsäge verwenden.
- Eine geeignete, ergonomische Entastungsmethode wählen, z. B. die Motorsäge, wenn möglich, zur Entlastung der Wirbelsäule auf dem Stamm abstützen.
- Auf sicheren Stand achten.
- Das Entasten mit der Schienenspitze vermeiden.
Achtung: Rückschlag der Motorsäge!
- Vor dem Abschneiden die Astspannungen beurteilen.
Beim liegenden Holz unter Spannung
- Vor dem Führen von Trennschnitten sind die Spannungsverhältnisse im Holz zu beurteilen.
- Zuerst in die Druckseite einen Entlastungsschnitt sägen und dabei die Gefahr des Einklemmens der Motorsäge beachten.
- Dann vorsichtig in die Zugseite sägen.
- Bei starken Stämmen mit starker Spannung Schnitt seitlich versetzen.
- Bei seitlicher Spannung immer auf der Druckseite stehen.
Für Wind- und Schneewurf gilt:
- Ausschließlich einzeln geworfene Bäume aufarbeiten. Für die Aufarbeitung von großflächigem Wind- und Schneewurf sind neben besonderer Qualifikation, große Erfahrung und besondere Arbeitsmittel erforderlich.
- Bei hochstehenden Wurzeltellern vor dem Trennschnitt:
- aufrecht stehende oder überhängende Wurzelteller sichern,
- sich vergewissern, dass sich niemand hinter dem Wurzelteller aufhält.
- Nach dem Trennschnitt:
- Auf Restspannungen achten,
- Wurzelteller zurückklappen.
- Nicht hinter ungesicherten Wurzeltellern arbeiten
- Wurzelteller z. B. mit gespanntem Seil sichern oder Sicherungsstück belassen. Faustregel: Die Länge des Sicherungsstückes (l) entspricht mindestens der Höhe des Wurzeltellers (h)!

Abb. 101 Sicherung durch Seil
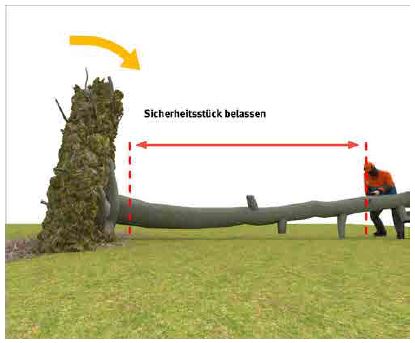
Abb. 102 Sicherung durch Sicherheitsstück
|
3.8.6 Arbeiten mit Buschholzhackern
Buschholzhackmaschinen werden für die Zerkleinerung von Schnittgut beim Baum- und Strauchschnitt eingesetzt. An handbeschickten Maschinen führt die Bedienperson das Schnittgut von Hand in einen Einzugstrichter. Durch Fehlbedienung oder sicherheitstechnische Mängel an den Maschinen können schwere Unfälle durch Zurückschlagen des Schnittgutes oder Einziehen von Körperteilen verursacht werden.

|
Weitere Informationen
|
- SVLFG Broschüre B08 "Baumarbeiten"
- SVLFG Broschüre B30 "Grünpflege im Gartenbau"
- Betriebsanleitung des Herstellers
|
|
Gefährdungen
|
|
Beim Arbeiten mit Buschholzhackmaschinen können folgende Gefährdungen auftreten:
- Einziehen von Gliedmaßen mit der Folge schwerer Verletzungen durch Einzugswalzen und Hackwerkzeuge
- Verletzungen durch Rückschlag des zugeführten Schnittguts
- Verletzungen durch das ausgeworfene Häckselgut
- Verletzungen durch nachlaufende Arbeitswerkzeuge, z. B. bei Störungsbeseitigung
- Bei Maschinen mit Gelenkwellenantrieb: Verletzungen an der rotierenden Gelenkwelle
- Gehörschädigung durch Lärm
|
|
Maßnahmen
|
|
Stellen Sie sicher, dass, abhängig von der Gefährdungsbeurteilung, gegen diese und weitere mögliche Gefährdungen folgende Maßnahmen getroffen werden:
Auswahl und sicherer Zustand der Maschine
- Es werden nur Maschinen eingesetzt, die dem Stand der Technik entsprechen z. B. hinsichtlich Schaltelementen und Zuführtrichterlänge
- An Maschinen mit Gelenkwellenantrieb sind die Verkleidungen der Gelenkwelle entsprechend der Herstellerangaben angebracht und die höchstzulässige Umdrehungszahl entsprechend der Betriebsanleitung wird nicht überschritten.
- Der Schaltbügel am Zuführtrichter ist funktionstüchtig, leichtgängig und befindet sich in allen Schaltstellungen vor den Konturen des Trichters.

Abb. 104 Schaltbügel
Betrieb der Maschine
Reinigungs- und Wartungsarbeiten, Störungsbeseitigung
- Die Arbeiten werden nur bei abgestelltem Antrieb und völligem Stillstand der Maschine durchgeführt. Es wird auch beachtet, dass selbst bei Stillstand der Maschine Gefährdungen beispielsweise durch gespeicherte Energien auftreten können. Daher werden die entsprechenden Hinweise in der Betriebsanleitung des Herstellers berücksichtigt.
 Gefährliche Arbeiten Gefährliche Arbeiten
Arbeiten mit Buschholzhackern sind gefährliche Arbeiten. Die Bedienperson muss mindestens 18 Jahre alt sein. Diese Arbeiten dürfen nicht in Alleinarbeit ausgeführt werden. Alternativen, die in anderen Bereichen bei gefährlichen Arbeiten eine Alleinarbeit ermöglichen (z. B. Kontrollgänge, Kontrollanrufe, Personen-Notsignal-Anlagen) lösen das Problem bei diesen Arbeiten nicht, denn Verletzungen, z. B. beim Einzug in die Maschine, können so schwerwiegend sein, dass unverzüglich Maßnahmen wie Stillsetzen der Maschine, Notruf, Erste Hilfe usw. notwendig sind.
 Persönliche Schutzausrüstungen/Arbeitskleidung Persönliche Schutzausrüstungen/Arbeitskleidung
Sorgen Sie dafür, dass die erforderliche persönliche Schutzausrüstung zur Verfügung steht, sich in einem einwandfreien Zustand befindet und vollständig getragen wird. Diese besteht für Bedienpersonen von Buschholzhackern aus:
- Schutzhelmkombination mit Gehör- und Gesichtsschutz
- eng anliegende Arbeitsbekleidung
- Schutzhandschuhe mit eng anliegenden Bündchen
- Sicherheitsschuhen
- gegebenenfalls Wetterschutzkleidung
- gegebenenfalls Warnkleidung (bei Arbeiten im Verkehrsraum)
Buschholzhacker mit RFID-Technologie
Diese neue Sicherheitstechnik besteht aus einer Sende-/Empfangseinheit im Trichter der Maschine und einem Schutzhelm mit einem Transponder. Beugt sich die Bedienperson zu weit in den Trichter hinein, so schaltet die Einzugswalze ab. Diese Technik behindert den Arbeitsablauf nicht und reduziert die Verletzungsgefahr erheblich.

|
|
3.8.7 Einsatz von Kappaggregaten an nichtforstlichen Maschinen
Immer häufiger werden Erdbaumaschinen, wie z. B. Ketten- und Radbagger, oder andere Maschinen, wie z. B. Teleskopstapler, mit einem Kappaggregat bestückt und bei Fäll- und Pflegearbeiten an Bäumen und Gehölzen eingesetzt. Dieser Einsatz bringt aber nicht nur Vorteile, sondern kann mit neuen Gefährdungen für Bediener und Bedienerinnen, unbeteiligte Dritte und die Umwelt verbunden sein. Dies können z. B. Defizite bei Bau und Ausrüstung der Maschinen, den Einsatzgrenzen bzw. der Standsicherheit der Maschine und der Schulung der Bediener und Bedienerinnen sein. Eine nicht zu unterschätzende Bedeutung bei der Vermeidung von Unfällen hat die Einhaltung der erweiterten Gefahrenbereiche.

|
Weitere Informationen
|
- DGUV Information 203-033 "Ausästarbeiten in der Nähe elektrischer Freileitungen"
- Betriebsanleitungen des Herstellers der Arbeitsmaschine und des Kappaggregats
|
|
Gefährdungen
|
|
Beim Betrieb von nichtforstlichen Maschinen mit angebauten Kappaggregaten können insbesondere folgende Gefährdungen bestehen:
- Umsturz des Trägerfahrzeugs durch zu hohe Dreh-/Kippmomente, weil die Gewichte der Baumstücke falsch eingeschätzt wurden,
- Unfälle durch Bauteilversagen aufgrund erhöhten Verschleißes (z. B. Drehkranz, Fahrgestell, Auslegergelenke) durch konstruktiv nicht berücksichtigte, aber infolge des geänderten Einsatzes auftretende Kräfte,
- Lebensgefahr für Bediener oder Bedienerin wegen unzureichendem Schutz der Kabine vor Stammteilen
- Lebensgefahr für Bediener oder Bedienerin wegen unzureichendem Schutz der Kabine vor weggeschleuderten Kettenteilen (z. B. bei Kettenriss, Kettenschuss),
- Gefährdung anderer Beschäftigte oder Personen durch Stammteile, reißende Ketten (Kettenschuss) oder das Gerät selber infolge Missachtung des erhöhten Gefahrenbereiches,
- Besondere Gefährdung in der Nähe zu elektrischen Freileitungen.
Beachten Sie:
Erdbaumaschinen, Teleskopstapler und ähnliche Geräte werden von den Herstellern nicht für Baumarbeiten konzipiert. Daher berücksichtigen die Hersteller die bei Baumarbeiten bestehenden Gefährdungen in ihrer Risikobeurteilung nicht. Weichen Sie also durch den Anbau eines Kappaggregates von der ursprünglichen bestimmungsgemäßen Verwendung ab, so kann aufgrund nicht bewerteter Risiken die EG-Konformitätserklärung des Herstellers erlöschen.
Klären Sie deshalb vor Beschaffung und Einsatz mit den Herstellern von Kappaggregat und Maschine die Zulässigkeit der Kombination und ggf. zusätzliche Schutzmaßnahmen! |
|
|
Maßnahmen
|
|
Stellen Sie sicher, dass, abhängig von der Gefährdungsbeurteilung, gegen diese und weitere mögliche Gefährdungen folgende Maßnahmen getroffen werden:
Tabelle 1: Einzuhaltende Schutzabstände bei Ausästarbeiten
Netz-Nennspannung
UN (Effektivwert) in kV |
Schutzabstand
(Abstand in Luft von ungeschützten unter
Spannung stehenden Teilen) in m |
| bis 1 |
1,0 |
| über 1 bis 110 |
3,0 |
| über 110 bis 220 |
4,0 |
| über 220 bis 380 |
5,0 |
| Unbekannt |
5,0 |

Abb. 110 Trägerfahrzeug mit Baumschere
|
3.9 Arbeiten in der Höhe
3.9.1 Arbeiten mit Hubarbeitsbühnen und Arbeitsplattformen
Hubarbeitsbühnen haben sich besonders in der Baumpflege bewährt. Mit ihrer Hilfe lassen sich Arbeiten einfach, ergonomisch und sicher auch in großer Höhe durchführen. Arbeitsplattformen sind Ausrüstungen zum Heben von Personen, die z. B. an Frontlader von Traktoren, Erdbaumaschinen oder Teleskopstaplern angebaut werden. Sie bieten nicht die gleiche Sicherheit wie Hubarbeitsbühnen, u. a. weil sie in der Regel nicht von der Arbeitsplattform aus gesteuert werden können. Die Verwendung ist deshalb nur eingeschränkt möglich.

|
Weitere Informationen
|
- DGUV Information 201-029 "Handlungsanleitung für Auswahl und Betrieb von Arbeitsplattformen an Hydraulikbaggern und Ladern"
- DGUV Information 203-033 "Ausästarbeiten in der Nähe elektrischer Freileitungen"
- DGUV Information 208-019 "Sicherer Umgang mit fahrbaren Hubarbeitsbühnen"
- DGUV Grundsatz 308-008 "Ausbildung und Beauftragung der Bediener von Hubarbeitsbühnen"
- LSV-Information T01 "Auswahl und Betrieb von Arbeitsplattformen an Traktoren"
- DIN EN 280 "Fahrbare Hubarbeitsbühnen – Berechnung – Standsicherheit – Bau – Sicherheit – Prüfungen"
- Betriebsanleitungen des Herstellers der Hubarbeitsbühne bzw. des Trägerfahrzeugs und der Arbeitsplattform
|
|
Gefährdungen
|
|
Die Gefährdungen beim Umgang mit fahrbaren Hubarbeitsbühnen und Arbeitsplattformen werden häufig unterschätzt. Sie entstehen im Wesentlichen durch Umkippen, Absturz und Quetschungen zwischen Arbeitskorb und Umgebung. Oft spielt dabei auch eine mangelnde Qualifikation der Bedienperson eine Rolle.
Insbesondere beim Einsatz von Teleskoparbeitsbühnen kann es zu einem Herausschleudern von Personen durch Peitschen- oder Katapulteffekt kommen. Dies kann z. B. der Fall sein wenn
- vorbeifahrende Fahrzeuge die Bühne streifen,
- der Ausleger sich durch nachgebenden Untergrund plötzlich bewegt,
- der Ausleger beim Verfahren mit angehobenem Arbeitskorb, z. B. durch das Überfahren eines Bordsteines oder beim Durchfahren von Bodenwellen, heftig ins Schwingen kommt oder
- der Arbeitskorb sich bei Baumarbeiten verhakt oder eingeklemmt wird und beim Freifahren plötzlich ins Schwingen kommt.
Arbeitsplattformen werden in der Regel an Trägerfahrzeuge angebaut, die nicht zum Heben von Personen bestimmt sind. Daher können beim Einsatz von Arbeitsplattformen zusätzliche Gefährdungen durch Absturz, Umsturz oder Kippen bestehen, wenn sicherheitstechnische Maßnahmen für diese spezielle Kombination nicht erfüllt sind.
Eine besondere Gefährdung kann sich auch aus der Nähe zu elektrischen Freileitungen ergeben.
|
|
Maßnahmen
|
| Beachten Sie zunächst die allgemeinen Hinweise in Kapitel 3.4. |
Hubarbeitsbühnen
Bei der Verwendung von Hubarbeitsbühnen (hierzu zählen auch Teleskopstapler mit Arbeitskorb an der Schnellwechseleinrichtung und Ausrüstung gemäß EN 280) ist – abhängig von der Gefährdungsbeurteilung – folgendes zu beachten:
- Bei der Auswahl der Hubarbeitsbühne sind die Tragfähigkeit und der Arbeitsbereich zu beachten. Die Tragfähigkeit setzt sich zusammen aus Personenzahl und Zuladung. Der Arbeitsbereich setzt sich zusammen aus Arbeitshöhe und seitlicher Reichweite.
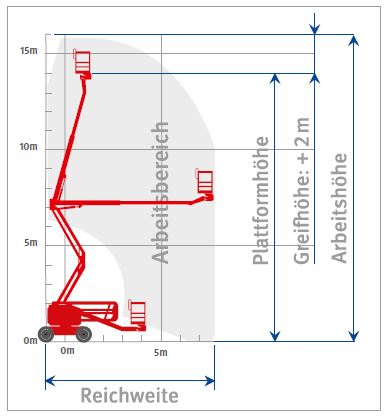
Abb. 113 Arbeitsbereich
- Hubarbeitsbühnen sind entsprechend der Betriebsanleitung standsicher aufzustellen. In der Regel sind lastverteilende Unterlegplatten erforderlich. Das ordnungsgemäße Aufsetzen von Abstützungen auf geeignetem Untergrund ist vor Inbetriebnahme zu prüfen. Kraftbetriebene Abstützungen sind beim Aus- und Einfahren zu beobachten.
- Werden Hubarbeitsbühnen im Verkehrsraum aufgestellt oder reichen sie in diesen hinein, so sind die beanspruchten Bereiche ordnungsgemäß abzusperren und zu sichern (siehe Kapitel 3.3). Hierbei ist auch der Raum unterhalb ausgeschwenkter Hubarbeitsbühnen und der Tragkonstruktionen zu berücksichtigen, sofern der freie Raum unterhalb der Konstruktionsteile oder des Arbeitskorbes weniger als 4,50 m beträgt.
- Zulässige Annäherungsabstände an ungeschützte aktive Teile elektrischer Freileitungen dürfen nicht unterschritten werden. Können diese Abstände nicht eingehalten werden, so müssen die Leitungen freigeschaltet und gegen Wiedereinschalten gesichert werden.
Bei bestimmten Bodenverhältnissen (z. B. im Gelände, im Bankett) reichen die vom Hersteller mitgelieferten Unterlegplatten oft nicht aus. Es müssen darüber hinaus zusätzliche Möglichkeiten zur Lastverteilung vorgesehen werden, z. B. Unterlagen aus Holz oder Stahlplatten.
 |

Abb. 115 Libelle zur Überprüfung der waagerechten Aufstellung
Tabelle 2: Einzuhaltende Schutzabstände bei Ausästarbeiten
Netz-Nennspannung
UN (Effektivwert) in kV |
Schutzabstand
(Abstand in Luft von ungeschützten unter
Spannung stehenden Teilen) in m |
| bis 1 |
1,0 |
| über 1 bis 110 |
3,0 |
| über 110 bis 220 |
4,0 |
| über 220 bis 380 |
5,0 |
| Unbekannt |
5,0 |
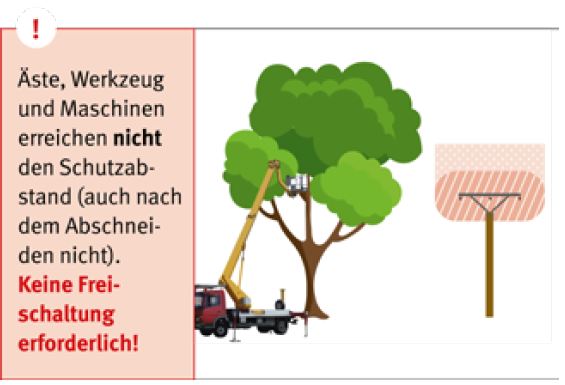
Abb. 116

Abb. 117
- Hubarbeitsbühnen dürfen nur in der Grundstellung und über die dafür bestimmten Zugänge bestiegen oder verlassen werden.
- Bei Überschreiten der nach der Betriebsanleitung zulässigen Windstärke ist der Betrieb einzustellen und die Hubarbeitsbühne in Ausgangsstellung zu bringen. Werden Baumarbeiten durchgeführt, so können bereits unterhalb dieses Wertes Gefährdungen bestehen, die eine Einstellung der Arbeiten erforderlich machen.
- Die Steuerung der Hubarbeitsbühne hat vom Arbeitskorb aus zu erfolgen.
- Ist die Person in der Arbeitsbühne handlungsunfähig, so ist mit Hilfe der Bodensteuerung die Arbeitsbühne in eine Position zu bringen, die ein sicheres Verlassen ermöglicht. Es ist erforderlich, dass an dieser Bodensteuerung eine klare Anweisung vorhanden ist, die beschreibt, wie sie im Notfall zu betätigen ist. Fällt die Hauptantriebsenergie aus, so kann mit Hilfe des Notablasses die Arbeitsbühne in ihre Grundstellung gebracht werden. Nur durch Einweisung und/oder durch regelmäßige Übung der Bedienung der Bodensteuerung und des Notablasses kann das Bodenpersonal im Notfall sicher und schnell reagieren.

|

|

|
Abb. 118 Steuerpult Hubarbeitsbühne im Korb |
Abb. 119 Bodensteuerung im Korb |
Abb. 120 Notablass |
Stellen Sie sicher, dass Ihre Beschäftigten folgendes beachten:
- Der Zugang zur Arbeitsbühne ist ordnungsgemäß geschlossen.
- Mitfahrende Personen beugen sich nicht über das Geländer.
- Die Arbeitsbühne darf nicht in Schwingungen versetzt werden.
- Ein Anstoßen an feste Teile der Umgebung ist zu vermeiden.
- Das Geländer darf nicht be- oder überstiegen werden.
- Die Vergrößerung der Reichweite durch Leitern oder andere Aufstiegshilfen in der Arbeitsbühne ist nicht zulässig.
- Arbeitsbühnen dürfen nicht überlastet werden, z. B. durch Ast- und Stammteile.
|
 Qualifikation für den Arbeitsschutz Qualifikation für den Arbeitsschutz
Hubarbeitsbühnen dürfen nur von Personen bedient werden, die
- mindestens 18 Jahre alt sind,
- in der Bedienung unterwiesen sind,
- ihre Befähigung dazu nachgewiesen haben und
- vom Unternehmer schriftlich beauftragt wurden.
- Die schriftliche Beauftragung bezieht sich immer auf eine ganz bestimmte Hubarbeitsbühne.
Sie haben geeignete Personen auszuwählen und deren Qualifikation sicherzustellen, z. B. durch eine Qualifizierung nach dem DGUV Grundsatz 308-008.
 Persönliche Schutzausrüstungen Persönliche Schutzausrüstungen
Das Tragen einer persönlichen Schutzausrüstung gegen Absturz (PSAgA) in Hubarbeitsbühnen wird verpflichtend, wenn die Gefährdungsbeurteilung (Absturz, z. B. durch Peitscheneffekt) und/oder die Betriebsanleitung des Hubarbeitsbühnenherstellers dies als notwendige Maßnahme vorgibt.
Besteht die Notwendigkeit der Benutzung einer PSAgA beim Bedienen der Hubarbeitsbühne, sind folgende Bedingungen einzuhalten, um ein Herausschleudern aus dem Arbeitskorb zu vermeiden:
- Im Arbeitskorb befinden sich vom Hersteller vorgesehene Anschlagpunkte in der Anzahl der zugelassenen Personen.
- Beachten Sie unter Berücksichtigung der Betriebsanleitung des Herstellers, dass bei dem Risiko des Herauskatapultierens aus einer Arbeitsbühne die geeignete PSAgA zur Verfügung zu stellen ist. Diese muss speziell für die Verwendung bestimmt und zugelassen sein, z. B. Höhensicherungsgeräte mit max. Gesamtlänge 1,8 m, kantengeprüft. Sorgen Sie dafür, dass die PSAgA bestimmungsgemäß benutzt wird.

Abb. 121 PSAgA im Arbeitskorb

Abb. 122 Anschlagpunkt für PSAgA im Arbeitskorb
Arbeitsplattformen an mobilen Arbeitsmitteln
Stehen geeignete Hubarbeitsbühnen nicht zur Verfügung, ist das Heben von Beschäftigten mit hierfür nicht vorgesehenen Arbeitsmitteln (z. B. Arbeitsplattformen auf den Gabeln von Teleskopstaplern, an Traktoren und Erdbaumaschinen) nur ausnahmsweise zulässig. In diesem Fall müssen Sie sicherstellen, dass die Sicherheit der Beschäftigten auf andere Weise gewährleistet ist.
Stellen Sie sicher, dass es sich nach den Herstellerangaben um eine zugelassene Kombination aus Arbeitsplattform und zum Heben eingesetztem Arbeitsmittel (Trägerfahrzeug) handelt (bestimmungsgemäßer Einsatz). Zudem müssen bestimmte technische Anforderungen erfüllt sein. Dies sind z. B.:
- Automatische Parallelführung, deaktivierte Kippfunktion, gedrosselte Hub-/Senkfunktion am Trägerfahrzeug
- Prüfung der Standsicherheit der Kombination
- Formschlüssige bzw. sicher verriegelte Verbindung zwischen Plattform und Trägerfahrzeug
- Siehe auch DGUV Information 201-029 und LSV Information T01.
Gewährleisten Sie mindestens folgende organisatorische Maßnahmen:
- Bei der Tätigkeit ist eine angemessene Aufsicht durch einen anwesenden besonders eingewiesenen Beschäftigten sichergestellt.
- Der Fahrerplatz des Trägerfahrzeugs ist ständig besetzt.
- Der mit der Steuerung des Trägerfahrzeugs beauftragte Beschäftigte ist hierfür besonders eingewiesen.
- Es stehen sichere Mittel zur Verständigung zur Verfügung, z. B. Sprechfunk oder Festlegung eindeutiger Verständigungszeichen (siehe ASR A1.3).
- Für den Notfall sind geeignete Rettungsmaßnahmen vorbereitet.
- Die zulässige Belastung und Personenzahl wird nicht überschritten.
- Der Aufenthalt unter der angehobenen Plattform ist verboten!
- Es ist für einen sicheren Stand des Trägerfahrzeugs zu sorgen. Bestehende Einsatzbeschränkungen an Hängen müssen beachtet werden.
- Das Trägerfahrzeug darf mit besetzter Plattform nicht verfahren werden. Ausgenommen hiervon sind langsame Fahrbewegungen zum Ausrichten an der Einsatzstelle (Fahrgeschwindigkeit höchstens 1 km/h bzw. ca. 0,3 m/s).
- Zulässige Annäherungsabstände zu ungeschützten aktiven Teilen elektrischer Freileitungen dürfen nicht unterschritten werden.
|
3.9.2 Arbeiten auf Kleingerüsten und fahrbaren Arbeitsbühnen
Kleingerüste und fahrbare Arbeitsbühnen bieten eine Alternative zur Steh- oder Anlegeleiter. Sie mindern die Unfallgefahr und bieten der arbeitenden Person einen besseren und sicheren Stand. Für umfangreichere Arbeiten in geringer Höhe sollte deshalb immer der Einsatz von schnell montierbaren Kleingerüsten oder fahrbaren Arbeitsbühnen erwogen werden. Behelfsgerüste, z. B. bestehend aus Stehleitern und Bohlen, entsprechen nicht mehr dem Stand der Technik. Sie sollten daher nicht mehr eingesetzt werden.

|
Weitere Informationen
|
- Fahrbare Arbeitsbühnen B 112 (BG Bau)
- Arbeitsschutz kompakt 023 "Arbeiten auf Kleingerüsten" (BGHM)
|
|
Gefährdungen
|
|
Fehlende Sicherungsmaßnahmen bei der Montage, unvollständiger Aufbau oder nicht sachgerechte Benutzung, z. B. beim Verfahren, können zu Absturz- oder Umsturzunfällen führen.
|
|
Maßnahmen
|
|
Stellen Sie sicher, dass, abhängig von der Gefährdungsbeurteilung, gegen diese und weitere mögliche Gefährdungen folgende Maßnahmen getroffen werden:
Auswahl
Den Beschäftigten steht ein geeignetes Kleingerüst oder eine geeignete fahrbare Arbeitsbühne an der Einsatzstelle zur Verfügung.
Aufbau
- Die Errichtung erfolgt nach der Betriebsanleitung des Herstellers. Diese liegt am Einsatzort vor.
- Kleingerüste und fahrbare Arbeitsbühnen werden nur unter der Aufsicht einer fachkundigen Person auf-, ab- oder umgebaut.
- Die Beschäftigten sind geeignet und speziell für diese Arbeiten unterwiesen.
- Beträgt die Höhe der Belagfläche mehr als 1,0 m, ist an der Arbeitsebene ein dreiteiliger Seitenschutz (Geländerholm, Zwischenholm und Bordbrett) vorhanden.
Verwendung
- Die zulässige Belastung wird beachtet.
- Vor dem Verfahren werden lose Teile auf der Belagfläche, z. B. Werkzeuge, gegen Herabfallen gesichert.
- Es wird nur in Längsrichtung oder über Eck verfahren. Jeglicher Anprall wird vermieden.
- Während des Verfahrens halten sich keine Personen auf dem Kleingerüst oder der fahrbaren Arbeitsbühne auf.
- Kleingerüste und fahrbare Arbeitsbühnen werden nur langsam und nur auf ebenem, tragfähigem und hindernisfreiem Untergrund verfahren.
- Vor jeder Benutzung werden die Fahrrollen durch Bremshebel festgesetzt.
- Auf Belagflächen wird nicht gesprungen.
- Auf Belagflächen wird nicht durch die Verwendung von Leitern, Kästen oder anderen Vorrichtungen die Arbeitshöhe vergrößert.
- Durchstiegsklappen sind außer beim Durchsteigen immer geschlossen.
- Hebezeuge werden nicht angebracht (Ausnahme: Die Betriebsanleitung lässt dies ausdrücklich zu).
Zusätzliche Maßnahmen bei fahrbaren Arbeitsbühnen
- Bei aufkommendem Sturm und nach Beendigung der Arbeiten werden fahrbare Arbeitsbühnen gegen Umsturz gesichert.
- Die Belaghöhe von im Freien eingesetzten fahrbaren Arbeitsbühnen beträgt maximal 8,0 m.
- Es sind sichere Aufstiegsmöglichkeiten vorhanden (innenliegende Leitern).
|
3.9.3 Arbeiten auf Leitern
Bei gärtnerischen Arbeiten – insbesondere bei Baumarbeiten – werden Leitern verschiedenster Bauart, wie Anlegeleitern, Stehleitern oder Einholmleitern, eingesetzt. Leider ereignen sich im Zusammenhang mit Leitern immer wieder schwere Unfälle. Vielen ist die Gefahr eines folgenschweren Absturzes – insbesondere bei Arbeiten in relativ geringen Höhen – nicht bewusst. Deshalb ist der Einsatz der Leiter auf Arbeiten geringeren Umfangs zu beschränken, bei denen es keine ergonomisch günstigere und/oder ungefährlichere Alternativen gibt. Es sollte also immer geprüft werden, ob z. B. Hubarbeitsbühnen, Arbeitsplattformen oder Teleskopsägen, zum Einsatz kommen können.

|
Weitere Informationen
|
- DGUV Information 208-016 "Handlungsanleitung für den Umgang mit Leitern und Tritten"
- SVLFG Broschüre B19 "Leitern"
- DIN EN 131-2 "Leitern – Teil 2: Anforderungen, Prüfung, Kennzeichnung"
- DIN 4567 "Leitern – Bemessungsgrundlagen für Leitern für den besonderen beruflichen Gebrauch"
|
|
Gefährdungen
|
|
Die Gefährdungen beim Umgang mit Leitern entstehen im Wesentlichen durch:
- Auswahl einer ungeeigneten Leiter;
- nicht bestimmungsgemäße Verwendung der Leiter;
- Verdrehen, Ab- oder Wegrutschen der Leiter wegen ungeeigneter Aufstellfläche (Leiterfuß) oder unzureichender Sicherung des Leiterkopfes;
- nicht angepasste Leiterfüße auf unebenem Standplatz;
- einseitiges Versinken des Leiterfußes;
- Verlust des Gleichgewichts und Umkippen der Leiter durch seitliches Hinauslehnen;
- Abrutschen von der Leitersprosse, z. B. durch ungeeignetes Schuhwerk oder abgenutzte Leitersprossen;
- Absturz aufgrund nicht erlaubter Verwendung von Maschinen mit Zweihandbedienung (z. B. Motorsägen);
- Versagen von Leiterteilen (Gelenkversagen, Sprossen- oder Holmbruch);
- Umkippen oder Wegrutschen der Anlegeleiter wegen falschem Anstellwinkel.
- Zusätzliche Gefahren können in der Nähe von elektrischen Freileitungen und Absturzkanten entstehen.
|
|
Maßnahmen
|
|
Stellen Sie sicher, dass, abhängig von der Gefährdungsbeurteilung, gegen diese und weitere mögliche Gefährdungen folgende Maßnahmen getroffen werden:
- Es wird eine den Einsatzbedingungen angepasste Leiter ausgewählt.
- Das Gelände und der Untergrund entscheiden über die Auswahl des geeigneten Leiterfußes. Gegen Abrutschen eignen sich Leiterfußspitzen für den Einsatz auf gewachsenem Boden, während Kunststoff- bzw. Gummifüße auf festem Untergrund (z. B. Betonsteinpflaster) verwendet werden. Eine Quertraverse gibt der Leiter zusätzliche Standsicherheit und vermindert die Gefahr, dass die Leiter in weichem Untergrund einsinkt.
- Bei der Auswahl geeigneter tragbarer Leitern werden ergonomische Gesichtspunkte beim Transport, der Aufstellung und der Benutzung berücksichtigt.
- Leiterteile von Steck- und Schiebeleitern werden vor der Benutzung fest miteinander verbunden.
- Für den Einsatz am Baum eignen sich Einholmleitern gut. Mit nur zwei Festpunkten (Astgabel und beweglich gelagerter Leiterfuß) lassen sich diese Leitern standsicher aufstellen. Zum Anstellen am Stamm wird die Stammgabel eingesetzt.

|

|

|
Abb. 125 Leiterfußspitzen |
Abb. 126 Zusammensetzbare Einholmleiter |
Abb. 127 Beweglich gelagerter Leiterfuß |
- Auf jeder Leiter, die Sie zur Verfügung stellen, befindet sich eine Kurzbedienungsanleitung in Form von Bildzeichen (Piktogrammen), die über wesentliche Sicherheitsaspekte informiert.
Bei der Verwendung von Leitern wird Folgendes beachtet:
- Von Leitern aus dürfen nur Arbeiten geringen Umfangs und geringer Gefährdung durchgeführt werden. Beispiele hierfür sind, wenn:
- der Standplatz auf der Leiter nicht höher als 3 m über der Aufstellfläche liegt,
- das Gewicht des mitzuführenden Werkzeugs und Materials 10 kg nicht überschreitet,
- keine Gegenstände mit einer Windangriffsfläche über 1 m2 mitgeführt werden.
- Die sichere Benutzung, insbesondere der sichere Kontakt zur Leiter und deren Standsicherheit, darf durch den Transport von Lasten auf der Leiter nicht eingeschränkt werden. Der sichere Kontakt zur Leiter ist z. B. gegeben, wenn sich die Beschäftigten beim Aufstieg mit einer Hand an der Leiter festhalten können. Zum Transport eignen sich Werkzeugtaschen, -gürtel und -schürzen.
- Beim Aufstellen von Anlegeleitern ist auf den richtigen Anstellwinkel (ca. 70°) (Ellenbogenmethode) zu achten.

|

|
Abb. 128 Leiterkopf zum Anlegen am Stamm |
Abb. 129 Leiterkopf zum Anlegen in eine Astgabel |

Abb. 130 Kurzbedienungsanleitung für Leitern
- In Abhängigkeit von der Arbeitsumgebung kann es erforderlich sein, die Standsicherheit der Anlegeleiter durch zusätzliche Maßnahmen sicherzustellen, z. B. Sicherung des Leiterkopfes durch einen Leitergurt.
- Anlegeleitern müssen die Ausstiegstelle zu höher gelegenen Flächen um mindestens 1 m überragen, wenn keine gleichwertigen Haltemöglichkeiten vorhanden sind.
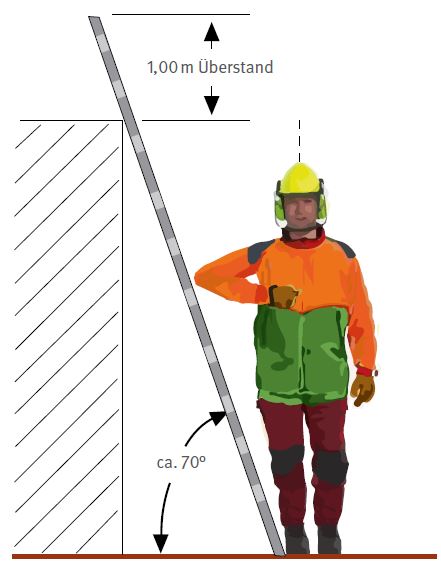
- Leitern bieten keinen sicheren Stand für Motorsägenarbeiten. Untersagen Sie deshalb Ihren Beschäftigten das unzulässige Arbeiten mit der Motorsäge von der Leiter aus! Lebensgefahr (siehe auch Kapitel 3.8.2)!
- Bei Baumschnittarbeiten wird die Leiter nicht durch Hilfskräfte gehalten, da sich diese sonst im Gefahrbereich von fallenden Ästen oder Stammteilen aufhalten würden.
- Bei ungünstigen Witterungsverhältnissen, die die Gefährdung der Beschäftigten erhöhen (stark böiger Wind, Schnee- oder Eisglätte) werden keine Arbeiten auf Leitern durchgeführt.
Bei Baumarbeiten bestehen zusätzliche Gefährdungen durch die Dynamik hoch-/zurückschnellender oder fallender Stammteile oder Äste. Verwenden Sie daher bei einer Standhöhe über 3 m Höhe auch auf Leitern Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz. Ein Auffanggurt mit seitlichen Halteösen in Verbindung mit einem längeneinstellbaren Sicherungsseil bietet Sicherheit gegen Abrutschen bzw. Absturz. Befestigt wird das Halteseil z. B. am Baumstamm, an tragfähigen Ästen oder Stammteilen.
 |
|
3.9.4 Arbeiten auf Dächern und Bauwerken
In den letzten Jahren hat die Zahl von Gebäuden mit Dachgärten oder begrünten Dächern stark zugenommen. Begrünte Dächer müssen in der Regel nur extensiv gepflegt werden und weisen deshalb häufig keine baulichen Absturzsicherungen (Brüstungen, Geländer) auf. Beim Pflegen dieser Flächen besteht Absturzgefahr. Die Unfallfolgen bei Abstürzen sind in der Regel erheblich. Auch bei der Pflege von Grünanlagen, z. B. Böschungen, in Verbindung mit Bauwerken, z. B. gärtnerische Anlagen an Straßenunterführungen oder tief liegende oder in den Hang gebaute Garagen, besteht Absturzgefahr.

|
Weitere Informationen
|
- DGUV Information 201-036 "Arbeitsplätze und Verkehrswege auf Dächern"
- DGUV Information 201-056 "Planungsgrundlagen von Anschlageinrichtungen auf Dächern"
- DGUV Information 201-057 "Maßnahmen zum Schutz gegen Absturz bei Bauarbeiten"
- DGUV Information 204-011 "Erste Hilfe – Notfallsituation: Hängetrauma"
- SVLFG Broschüre B22 "Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau"
- DIN 4426 "Sicherheitstechnische Anforderungen an Arbeitsplätze und Verkehrswege"
- "Leitfaden zur Absturzsicherung"; Fachvereinigung Bauwerksbegrünung e. V.
|
|
Gefährdungen
|
|
Bei Grünpflegearbeiten auf Dächern oder anderen Bauwerken ohne feste Absturzsicherungen können bestehen:
- Durchbruchgefahr durch nicht trittsichere Bauteile (z. B. Lichtkuppeln),
- Absturzgefahr an Absturzkanten ab einer Absturzhöhe größer 1 m,
- Abrutschgefahr auf geneigten Flächen,
- Pendelsturz bei nicht bestimmungsgemäßer Nutzung von Persönlicher Schutzausrüstung gegen Absturz (PSAgA).
|
|
Maßnahmen
|
|
Führen Sie grundsätzlich vor dem Beginn von Pflegemaßnahmen eine objektbezogene Gefährdungsbeurteilung durch!
Die zu pflegenden Flächen müssen durch bauliche Einrichtungen sicher erreichbar sein. Sichere Zugänge können z. B. sein:
- Treppen,
- Steigleitern,
- Türen,
- Ausstiegsfenster.
Beim Materialtransport dürfen für die Beschäftigten keine zusätzlichen Gefahren entstehen.
Stellen Sie sicher, dass Ihre Beschäftigten nur in Bereichen arbeiten, die durchbruchsicher sind. Nicht durchbruchsichere Einrichtungen wie Lichtkuppeln sind zu sichern oder der Gefahrenbereich ist deutlich zu kennzeichnen.
Arbeitsplätze und Verkehrswege, bei denen der Abstand mehr als 2,0 m zur Absturzkante beträgt, liegen außerhalb des Gefahrenbereichs Absturz. Der Gefahrenbereich ist durch geeignete Maßnahmen, z. B. Ketten oder Seile, und gut sichtbare Kennzeichnung entsprechend ASR A1.3 "Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung" (Verbotszeichen D-P006 "Zutritt für Unbefugte verboten") gegen unbefugten Zutritt zu sichern.
Bauliche oder technische Maßnahmen haben Vorrang vor dem Einsatz von Persönlichen Schutzausrüstungen gegen Absturz!
Wenn Absturzgefahr besteht, müssen Maßnahmen gegen Absturz ergriffen werden, z. B.:
- Schutzgeländer,
- Gerüste,
- mobile Arbeitsbühnen,
- Auffangeinrichtungen.
Lassen sich keine Absturzsicherungen oder Auffangeinrichtungen einrichten oder ist der Aufwand für kurzzeitige Einsätze unangemessen hoch, sind Persönliche Schutzausrüstungen gegen Absturz (PSAgA) zu verwenden. Voraussetzung für die Verwendung von PSAgA ist das Vorhandensein geeigneter Anschlageinrichtungen.
| Insbesondere bei der Neuanlage von Dachbegrünungen ist darauf zu achten, dass sie später gefahrlos betreten werden können. Wenn die Art der Nutzung ein häufigeres Betreten erfordert, sind feste Absturzsicherungen wie Mauern oder Geländer erforderlich! Ansonsten sind mindestens geeignete Anschlageinrichtungen vorzusehen. |

Abb. 134 Sicherung gegen Durchsturz
 Besondere Unterweisung Besondere Unterweisung
Sie müssen Beschäftigte, die mit PSAgA arbeiten, besonders unterweisen. Bei diesen Unterweisungen müssen die Benutzungsinformationen mit Übungen vermittelt werden.

Abb. 135 Geländer
 Gefährliche Arbeiten Gefährliche Arbeiten
Arbeiten mit Absturzgefahr können gefährliche Arbeiten sein, die nicht in Alleinarbeit durchgeführt werden dürfen. Dies betrifft insbesondere Arbeiten mit PSAgA, die außerhalb von Ruf- und Sichtweite zu anderen Personen ausgeführt werden.
Alternativen, die in anderen Bereichen bei gefährlichen Arbeiten eine Alleinarbeit ermöglichen (z. B. Kontrollgänge, Kontrollanrufe, Personen-Notsignal-Anlagen) lösen das Problem bei diesen Arbeiten nicht, denn Verletzungen, z. B. durch Pendelsturz, Fangstoß oder Verweildauer im Gurt können so schwerwiegend sein, dass unverzüglich Rettungsmaßnahmen notwendig sind.

Abb. 136 Geeignete Anschlagsicherung
|
3.10 Arbeiten an Gewässern
Grün- und Landschaftspflegearbeiten an Gewässern werden im Rahmen von Unterhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen oder Neubauvorhaben an Kanälen, Flüssen, im Seebereich sowie in anderen Gewässern durchgeführt. Diese Arbeiten sind mit vielfältigen Gefahren verbunden. Besonders wichtig sind hierbei Schutzmaßnahmen gegen das Hineinfallen und das Ertrinken.

|
Weitere Informationen
|
- Film DVD "Retten aus dem Wasser" (2014, Unfallversicherung Bund und Bahn)
- DIN EN ISO 12402-2 "Persönliche Auftriebsmittel – Rettungswesten, Stufe 275"
- DIN EN ISO 12402-3 "Persönliche Auftriebsmittel – Rettungswesten, Stufe 150"
- DIN EN 14144 "Rettungsringe"
- DIN EN 1914 "Fahrzeuge der Binnenschifffahrt – Arbeits-, Bei- und Rettungsboote"
|
|
Gefährdungen
|
|
Bei Grün- und Landschaftspflegearbeiten an Gewässern treten häufig folgende Gefährdungen auf:
- Verletzungsgefahr durch Sturz ins Wasser, z. B. durch
- Hindernisse im Wasser (sichtbar/nicht sichtbar)
- Ausrüstungsgegenstände und Arbeitsmittel
- Gefahr des Ertrinkens, z. B. in Folge von
- Kleidung, die unter Wasser zieht,
- Ausrüstung, die unter Wasser zieht,
- Strömung,
- fehlender Ausstiegsmöglichkeit,
- Kälte.
- Verletzungsgefahr durch unsicheren Stand in Ufer- und Böschungsnähe
- Umsturz- bzw. Absturzgefahr von Arbeitsmitteln infolge nicht ausreichender Tragfähigkeit der Uferzone beispielsweise durch Nässe oder Unterspülungen
|
|
Maßnahmen
|
|
Je nach ihrer Beschaffenheit können Gewässer ein sehr unterschiedliches Gefahrenpotential aufweisen. Ermitteln Sie Im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung explizit das Gefahrenpotential. Stellen Sie sicher, dass, abhängig von der Gefährdungsbeurteilung, gegen diese sowie weitere mögliche Gefährdungen folgende Maßnahmen getroffen werden:
 Automatische Rettungswesten Automatische Rettungswesten
Stellen Sie bei allen Arbeiten an Gewässern, bei denen die Gefahr des Ertrinkens besteht, automatische Rettungswesten zur Verfügung, die von den Beschäftigten bestimmungsgemäß zu verwenden sind. Feststoffrettungswesten sind in der Regel durch das große Volumen und die dadurch bedingten Bewegungseinschränkungen nicht geeignet. Rettungswesten sollten mindestens 150 N Auftrieb haben. Bei der Kombination der Rettungsweste mit weiteren persönlichen Schutzausrüstungen (z. B. Schutzkleidung, Kälteschutzausrüstung oder Wetterschutzkleidung) ist eine Rettungsweste mit mindestens 275 N Auftrieb zwingend erforderlich. Automatische Rettungswesten müssen immer über der Kleidung, d. h. auch über Regenbekleidung, getragen werden, damit das Aufblasen des Auftriebskörpers nicht behindert wird.
Rettungsmittel
Stellen Sie sicher, dass neben Rettungswesten vor Ort gegebenenfalls auch Rettungsmittel bereit gehalten werden:
- Bei stehenden Gewässern wie Teiche, Seen oder Talsperren ist ein Rettungsring mit schwimmfähiger Rettungsleine bzw. ein entsprechender Wurfsack erforderlich.
- An fließenden Gewässern ist gegebenenfalls ein zur Rettung geeignetes Boot bereitzustellen. An stark strömenden Gewässern muss das Boot mit einem Motor ausgerüstet sein.
 Persönliche Schutzausrüstungen Persönliche Schutzausrüstungen
Besondere Situationen wie beispielsweise stark geneigte Uferböschungen oder ungünstige Strömungsverhältnisse können zusätzliche Schutzmaßnahmen gegen Absturz bzw. Hineinfallen in das Wasser erfordern. Diese können geeignete Sicherungssysteme mit Rückhalteeinrichtung sein.

Abb. 139 Rettungsweste
Betriebsanweisungen
Für das Arbeiten an Gewässern sowie für die Benutzung der Rettungswesten müssen Sie Betriebsanweisungen erstellen und diese den Beschäftigten in geeigneter Form zur Verfügung stellen.
 Unterweisungen Unterweisungen
Regelmäßige Mitarbeiterunterweisungen, die durch geeignete praktische Übungen ergänzt werden, vermitteln in geeigneter Form das sachgerechte Anlegen und die sichere Handhabung der Rettungsweste.
 Gefährliche Arbeiten Gefährliche Arbeiten
Keine Alleinarbeit
Arbeiten an Gewässern sind gefährliche Arbeiten. Alternativen, die in anderen Bereichen bei gefährlichen Arbeiten Alleinarbeit ermöglichen (z. B. Kontrollgänge, Kontrollanrufe, Personen-Notsignal-Anlagen) lösen das Problem bei Arbeiten an Gewässern nicht. Aus diesem Grund ist Alleinarbeit nicht zulässig.
Auswahl geeigneter Geräte
Bei der Auswahl von Geräten sind die Ufereigenschaften in besonderer Weise zu beachten.
Um zu vermeiden, dass Beschäftigte im Gefahrenbereich arbeiten müssen, werden beispielsweise Auslegermähwerke oder ferngesteuerte Mähgeräte eingesetzt.

Abb. 140 Mäharbeiten an Grabenböschung
| Weitergehende Regelungen für Arbeiten an Gewässern sowie Arbeiten auf dem Wasser sind der DGUV Regel 114-014 "Wasserbauliche und wasserwirtschaftliche Arbeiten" zu entnehmen. |
|
3.11 Arbeiten mit Gefahrstoffen
3.11.1 Umgang mit Gefahrstoffen
Bei gärtnerischen Arbeiten werden zum Teil auch Gefahrstoffe eingesetzt. Das sind Stoffe, die insbesondere bei nicht sachgerechtem Umgang, auf Grund ihrer gefährlichen Eigenschaften negative Auswirkungen auf den Mensch oder die Umwelt haben können.

|
Rechtliche Grundlagen
|
- Pflanzenschutzgesetz (PflSchG)
- Gefahrstoffverordnung (GefStoffV)
- Technische Regeln für Gefahrstoffe (z. B. TRGS 500 "Schutzmaßnahmen")
- Pflanzenschutz-Sachkundeverordnung (PflSchSachkV)
|
|
Weitere Informationen
|
- DGUV Information 213-030 "Gefahrstoffe auf Bauhöfen im öffentlichen Dienst"
- SVLFG Broschüre B29 "Gefahrgut sicher transportieren"
- SVLFG Broschüre B26 "Gefahrstoffe"
- Sicherheitsdatenblatt des Herstellers
- Kennzeichnungshinweise auf der Verpackung
- Gefahrstoffdatenbanksysteme im Internet (z. B. WINGIS, GESTIS)
|
|
Gefährdungen
|
|
Bei Tätigkeiten mit Gefahrstoffen können folgende Gefährdungen auftreten:
- Akute und subakute Vergiftungen, z. B. durch Kraftstoffdämpfe, Pflanzenschutzmittel, Abgase von verbrennungsmotorisch angetriebenen Arbeitsmitteln wie Motorsägen, Freischneider, Rasenmäher
- Erkrankungen durch chronische Wirkungen von Gefahrstoffen, z. B. durch Verwendung benzolhaltiger Ottokraftstoffe
- Reizungen oder Verätzungen, z. B. durch das Gelangen von Kraftstoff auf die Haut oder in die Augen
- Brände, Verpuffungen und Explosionen, z. B. durch Entzünden brennbarer Flüssigkeiten oder Gase an heißen Maschinenteilen, defekte Akkumulatoren
- Umweltschäden, z. B. durch Leckagen, Tropfverluste bei Betankungs- oder Umfüllvorgängen
|
|
Maßnahmen
|
|
Stellen Sie sicher, dass, abhängig von der Gefährdungsbeurteilung, gegen diese und weitere mögliche Gefährdungen folgende Maßnahmen getroffen werden:
Auswahl von Arbeitsstoffen und Arbeitsverfahren
Einsatz von Gefahrstoffen
- Beachten Sie die Hinweise des Herstellers auf der Kennzeichnung des Produktes.
Gefahrenpiktogramme für Gefahrstoffe
Der Hersteller muss bereits auf der Verpackung des Erzeugnisses erste Hinweise auf die gefährlichen Eigenschaften des Stoffes (bzw. Gemisches) geben. Im Zeitraum von Januar 2009 bis Juni 2015 wurde in der EU ein neues System zur Einstufung und Kennzeichnung von Gefahrstoffen eingeführt (CLP). Es orientiert sich in weiten Teilen am Global Harmonized System (GHS). Damit war unter anderem auch die Einführung neuer Gefahrenpiktogramme verbunden. |
- Beschaffen Sie in jedem Fall das aktuelle Sicherheitsdatenblatt des Herstellers zu dem Gefahrstoff (muss vom Hersteller bzw. Vertreiber zur Verfügung gestellt werden, ggf. im Internet).
- Erstellen Sie ein Gefahrstoffverzeichnis um den Überblick über im Unternehmen eingesetzte Gefahrstoffe zu behalten. Das Verzeichnis muss mindestens folgende Angaben enthalten:
- Bezeichnung des Gefahrstoffes
- Einstufung des Gefahrstoffes und Angaben zu den gefährlichen Eigenschaften
- Arbeitsbereich in dem mit dem Gefahrstoff umgegangen wird bzw. in dem der Gefahrstoff entsteht
- Verwendete Mengen im Arbeitsbereich
- Verweis auf das Sicherheitsdatenblatt (gemäß GefStoffV § 6(12))
- Personen, die mit Gefahrstoffen umgehen müssen mindestens 18 Jahre alt sein. Ausnahmen sind unter Beachtung des Jugendarbeitsschutzgesetzes für Auszubildende über 15 Jahren möglich, sofern dies zur Erreichung des Ausbildungszieles unbedingt erforderlich ist und der Schutz durch die Aufsicht einer fachkundigen Person gewährleistet ist und darüber hinaus die zulässigen Luftgrenzwerte eingehalten werden.
- Beachten Sie die Bestimmungen zum Mutterschutz bei Tätigkeiten mit Gefahrstoffen.
- Die vom Hersteller vorgegebenen Gefahrenhinweise (Hazard-Statements bzw. H-Sätze) und Sicherheitshinweise (Precautionary-Statements bzw. P-Sätze), die auf der Verpackung oder im betreffenden Sicherheitsdatenblatt vermerkt sind, werden beim Umgang mit dem Gefahrstoff beachtet und in die Gefährdungsbeurteilung einbezogen.
- Auf der Grundlage der Ergebnisse der Gefährdungsbeurteilung wird eine spezielle Betriebsanweisung zu Tätigkeiten mit dem Gefahrstoff erstellt, die allen betroffenen Beschäftigten zugänglich ist. Die Beschäftigten werden auf Grundlage der Betriebsanweisung unterwiesen (z. B. Betriebsanweisung Betanken von Geräten).
- Den Beschäftigten wird die, gemäß den Sicherheitshinweisen des Herstellers, der Hinweise im Sicherheitsdatenblatt bzw. der nach den Ergebnissen der Gefährdungsbeurteilung notwendige, persönliche Schutzausrüstung zur Verfügung gestellt. Die Beschäftigten haben diese persönliche Schutzausrüstung bestimmungsgemäß zu verwenden.
- Bei Tätigkeiten mit Gefahrstoffen wird auf besondere Hygiene geachtet und es wird auf Essen, Trinken und Rauchen verzichtet.
- Es werden gemäß der Angaben des Herstellers bzw. der Ergebnisse der Gefährdungsbeurteilung geeignete Hautschutzmaßnahmen umgesetzt.
- Setzen Sie für Maßnahmen des chemischen Pflanzenschutzes nur Beschäftigte ein, die über die notwendige Sachkunde gemäß Pflanzenschutzgesetz bzw. Pflanzenschutz-Sachkundeverordnung verfügen.
- Bewahren Sie Gefahrstoffe wenn möglich in ihren vom Hersteller mitgelieferten Originalgebinden (Behältern) auf. Andernfalls verwenden Sie sichere Behälter (z. B. Behälter nach Gefahrguttransportrecht mit "UN-Codierung") und übernehmen die Sicherheitskennzeichnung des Originalgebindes.
- Vermeiden Sie, wenn möglich, Umfüll- oder Anmischprozesse, indem Sie geeignete Gebindegrößen bzw. Fertiggemische beschaffen.
- Sind Umfüll- oder Anmischprozesse unumgänglich, so sorgen Sie dafür, dass diese Tätigkeiten an gut belüfteten Orten (z. B. im Freien) stattfinden oder dass ausreichende Lüftungstechnische Maßnahmen ergriffen werden. Beachten sie dabei den Explosionsschutz.
- Verwenden Sie keine Behälter, bei denen Verwechslungsgefahr mit Lebensmittelbehältern besteht.
Reinigungs- und Wartungsarbeiten, Störungsbeseitigung, Notfälle
- Beim Betanken von Maschinen und Geräten mit Verbrennungsmotor wird der Motor des Gerätes abgestellt. Das Betanken erfolgt nur an gut belüfteten Orten. Ein versehentliches Benetzen der Bekleidung wird durch geeignete Tankhilfen vermieden. Mit Kraftstoff benetzte Bekleidung wird sofort gewechselt. Bei der Benetzung von Augen oder Haut ist nach den Sicherheitshinweisen des Herstellers des Kraftstoffes Erste Hilfe zu leisten.
- Stellen Sie Hilfsmittel für die sichere Aufnahme von ungewollt ausgetretenen Gefahrstoffen zur Verfügung (z. B. Bindemittel zur Aufnahme von ausgetretenem Kraftstoff oder Mineralöl).
- Ergreifen Sie Maßnahmen zum vorbeugenden Brandschutz und zur Brandbekämpfung (z. B. Feuerlöscher für Fahrzeuge und selbstfahrende Arbeitsmaschinen).
- Prüfen Sie, ob neben dem vorgeschriebenen Verbandkasten zusätzliche technische Mittel für die Erste Hilfe erforderlich sind (z. B. Augenspülflasche bei Betankung mit Kanistern).
 Persönliche Schutzausrüstungen Persönliche Schutzausrüstungen
Sorgen Sie dafür, dass die erforderliche persönliche Schutzausrüstung (PSA) gemäß Ihrer Ermittlungen aus der Gefährdungsbeurteilung zur Verfügung steht, sich in einem einwandfreien Zustand befindet und vollständig getragen wird. Hinweise zur PSA können dem Sicherheitsdatenblatt des Herstellers entnommen werden.
Bei Tätigkeiten mit Gefahrstoffen können dies unter anderem folgende PSA sein:
- Augen- oder Gesichtsschutz
- Chemikalienschutzhandschuhe
- Atemschutz (z. B. Atemschutzmasken, gebläseunterstützte Atemschutzgeräte)
- Fußschutz (z. B. Gummistiefel)
- Pflanzenschutz- bzw. Chemikalienschutzanzüge
|
3.11.2 Transport von Gefahrstoffen
Im Zusammenhang mit Arbeiten der Grün- und Landschaftspflege werden auch Stoffe und Gemische befördert, die gefährliche Eigenschaften besitzen. Man bezeichnet sie dann als Gefahrgüter bezogen auf den Transportvorgang. Es ist im Einzelfall zu prüfen, ob bestimmte Gefahrstoffe auch unter das Gefahrgutrecht fallen. Hinweise dazu gibt das Sicherheitsdatenblatt. Beachten Sie, dass auch bestimmte Produkte wie Lithiumbatterien oder Abfälle Gefahrgut sein können. Beispiele hierfür wären etwa der Transport von Kraft- und Hilfsstoffen für Maschinen und Geräte, wie Benzinkanister für den Rasenmäher, Kombikanister mit Sonderkraftstoff und Kettenöl für die Motorsäge, Dieselfass für einen Aufsitzmäher oder Sammelbehälter für Altöl.

|
Rechtliche Grundlagen
|
- "Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße" (ADR)
- Gefahrgutbeförderungsgesetz (GGBefG)
- "Gefahrgutverordnung Straße, Eisenbahn und Binnenschifffahrt" (GGVSEB)
- "Gefahrgutausnahmeverordnung" (GGAV)
- "Gefahrgut-Beauftragtenverordnung" (GbV)
- Durchführungsrichtlinien Gefahrgut (RSEB)
|
|
Weitere Informationen
|
- DGUV Information 213-052 "Beförderung gefährlicher Güter"
- SVLFG Broschüre B29 "Gefahrgut sicher transportieren"
- Sicherheitsdatenblatt des Herstellers
- Kennzeichnungshinweise auf der Verpackung
|
|
Gefährdungen
|
|
Beim unsachgemäßen Transport von Gefahrgütern können z. B. folgende Gefährdungen bestehen:
- Akute Vergiftungen
- Verätzungen, Reizungen
- Brände
- Verpuffungen und Explosionen
- Umweltschäden
|
|
Maßnahmen
|
|
Stellen Sie sicher, dass, abhängig von der Gefährdungsbeurteilung, gegen diese und weitere mögliche Gefährdungen folgende Maßnahmen getroffen werden:
Allgemeine Maßnahmen
- Beachten Sie die Hinweise zum Transport auf der Produktverpackung.
- Beschaffen Sie in jedem Fall das Sicherheitsdatenblatt des Herstellers zu dem Gefahrstoff und informieren Sie sich insbesondere im Abschnitt 14 über die Vorgaben beim Transport.
- Die Vorgaben zum Regeltransport von Gefahrgut sind sehr weitreichend und aufwändig (z. B. ADR Führerschein, Kennzeichnung Fahrzeug). Prüfen Sie deshalb, ob die Inanspruchnahme einer Ausnahme oder anderer Erleichterungen beim Transport der Gefahrgüter möglich ist.
Mögliche Ausnahmeregelungen für Freistellung von den Vorgaben des ADR bzw. den Reglungen der GGVSEB sind:
- Transport nach 1.1.3.6 ADR (sogenannte "1000-Punkte-Regel")
- Transport nach 1.1.3.1c ADR ("Transport im Rahmen der Haupttätigkeit")
|
- Verwenden Sie ausschließlich Transportbehälter, die den zu erwartenden Beanspruchungen beim Transport standhalten können (z. B. zugelassene bzw. baumustergeprüfte Behälter).
- Beachten Sie, dass Kunststoffbehälter nur maximal bis zu 5 Jahren nach dem Herstellungsdatum für den Gefahrguttransport verwendet werden dürfen (siehe Herstellungsprägung). Metallkanister können so lange benutzt werden, wie sie unbeschädigt und funktionstüchtig sind (z. B. der Sicherungssplint am Metallkanister vorhanden ist).
- Sorgen Sie für eine deutliche Kennzeichnung der Transportbehälter nach Gefahrstoff- und Gefahrgutbestimmungen!
- Achten Sie auf eine ausreichende Ladungssicherung einschließlich der Gefahrgutbehälter. Dies beinhaltet z. B. auch
- Nicht zum Transport zugelassene Tankhilfen und Einfüllstutzen an Kraftstoffbehältern entfernen und Behälter mit Originaltankverschluss sichern,
- Metallkanister verschließen und mit Sicherungssplint versehen,
- Druckminderer, Manometer, Schlauchbruchsicherungen und andere Zusatz- und Verbrauchseinrichtungen an Gasflaschen entfernen, Ventil schließen und Ventilschutzkappe verwenden.
- Sorgen Sie beim Transport von Druckgasflaschen, Aerosolverpackungen und Druckgaskartuschen in geschlossenen Fahrzeugen für ausreichende Belüftung und das sie nie im Fahrer- bzw. Fahrgastraum transportiert werden.
- Unterweisen Sie die Personen, die am Gefahrguttransport beteiligt sind an Hand des dazugehörigen Sicherheitsdatenblatts und des Unfallmerkblattes für dieses Gefahrgut. Dokumentieren Sie diese Unterweisung.
- Stellen Sie den am Transport beteiligten Beschäftigten die erforderlichen persönlichen Schutzausrüstungen und Hilfsmittel (z. B. Bindemittel, Schachtabdeckungen) zur Verfügung.
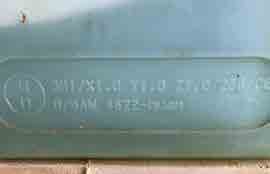
|

|
Abb. 144 UN-Zulassung für Gefahrgüter auf einem Kunststoffkanister |
Abb. 145 Ordnungsgemäß gesicherte Flüssiggasflasche mit Ventilschutzkappe |
Transport kleiner Mengen
Transport im Rahmen der "1000-Punkte-Regel"
Unter diese Ausnahmeregelung mit diversen Erleichterungen fallen Transporte von Gefahrgut mit geringer Gefahrgutmenge, wobei auch unterschiedliche Gefahrgüter gemeinsam transportiert werden können, ohne dass es sich um einen "Regeltransport" nach GGVSEB mit seinen umfassenden Anforderungen an die Fahrerin oder den Fahrer, das Fahrzeug, an einzuhaltende Fahrstrecken u. a. m. handelt. Diese Ausnahme ist an folgende Bedingungen gebunden:
- Es ist ein Beförderungspapier nach 5.4.1 ADR zu erstellen und mitzuführen.
- Die Höchstmengen bzw. 1000 Punkte dürfen nicht überschritten werden.
- Es sind zugelassene Behälter zu verwenden (baumustergeprüft).
- Die Beförderung in Tanks ist unzulässig.
- Die Ladung ist vorschriftsmäßig gekennzeichnet, bezettelt und gesichert.
- Die am Transport beteiligten Personen sind unterwiesen worden und ein Unterweisungsnachweis liegt vor.
- Ein geeigneter Feuerlöscher (mindestens 2 kg ABC) ist verplombt mitzuführen. Er muss leicht erreichbar und gegen Witterungseinflüsse geschützt sein. Er ist gemäß Prüfungsplakette regelmäßig prüfen zu lassen.
Bis zum 30.06.2021 kann nach Ausnahme 18 der GGAV das Beförderungspapier entfallen, vorausgesetzt das Gefahrgut wird keinem Dritten überlassen. Ein Beförderungspapier muss mindestens folgende Angaben in dieser Reihenfolge enthalten:
- Kennzeichnung durch UN-Nummer mit vorgestelltem "UN"
- Beschreibung des Gefahrgutes nach ADR
- Gefahrgutklasse mit eventuell Nebengefahr in Klammern, z. B. 6.1 (3)
- Verpackungsgruppe z. B. I, II oder III und
- Tunnelcode (A – E), z. B. UN 1202 Diesel, 3, VG III, (E)
Die folgende Tabelle beinhaltet Höchstmengen, die beim Transport im Rahmen der "1000-Punkte-Regel" einzuhalten sind. Werden verschiedene Stoffe gemeinsam transportiert, so wird die Menge mit den o. g. Berechnungsfaktoren multipliziert, wobei die Höchstmenge und die 1000 Punkte nicht überschritten werden dürfen!
Gefahrgutbezeichnung/
Handelsname |
VG |
Stoff
(UN)-Nummer |
Klasse |
Höchstmenge |
Berechnungsfaktor |
| Benzin/Benzin-Gemisch |
II |
1203 |
3 |
333 Liter |
3 |
| Diesel |
III |
1202 |
3 |
1000 Liter |
1 |
| Propan (verflüssigt) |
entfällt |
1978 |
2 |
333 kg |
3 |
| Li-Ionen-Akkus (≤ 100 Wh/Batterie) |
II |
3480/3481 |
9 |
333 kg |
3 |
Beispiel
Es sollen transportiert werden:
- 100 Liter Benzin,
- 600 Liter Diesel und eine
- Gaskartusche von 30 kg.
Rechenbeispiel:
100 Liter Benzin 100 x Faktor 3 = 300 Punkte
600 Liter Diesel 600 x Faktor 1 = 600 Punkte
30 kg Gas 30 x Faktor 3 = 90 Punkte
Summe: 990 Punkte
Da die Summe 1000 Punkte unterschritten wird, darf in diesem Beispiel von der beschriebenen Ausnahmereglung Gebrauch gemacht werden. |
Transport im Rahmen der "Haupttätigkeit"
Unter diese Freistellung fallen Transporte von Gefahrgütern für eigene Zwecke, die von Unternehmen in Verbindung mit ihrer eigentlichen Haupttätigkeit (z. B. Mäharbeiten) durchgeführt werden müssen. Dies sind z. B. Transporte von Arbeitsmaterialien und Hilfsstoffen, die unmittelbar zum Fortgang der Arbeiten am Einsatzort benötigt werden.
Transporte, die zur internen und externen Versorgung durchgeführt werden (z. B. der Einkauf beim Großhändler), fallen nicht unter diese Regelung.
Eine Freistellung kann in Anspruch genommen werden, wenn
- je Verpackung die Füllmenge von 450 Liter ("Handwerkerregelung") und
- die Höchstmengen des gesamten beförderten Gefahrguts nach Abschnitt 1.1.3.6 ADR (1000-Punkte-Regel) eingehalten werden.
Behälter und ihre Kennzeichnung
Behälter, in denen Gefahrgüter transportiert werden sollen, müssen den beim Transport zu erwartenden Beanspruchungen standhalten. Dies erfüllen z. B. baumustergeprüfte Behälter.
Daher unterliegen Gefahrgutverpackungen definierten Bau- und Prüfvorschriften! Geeignete Gefahrgutverpackungen sind an der "UN-Codierung" bzw. an dem Verpackungssymbol "Vereinte Nationen" erkennbar.
Darüber hinaus müssen die Behälter für den zu transportierenden Gefahrstoff geeignet sein.
Welche Verpackung bzw. Behälter beim Transport zu verwenden sind, muss der Hersteller, Vertreiber oder Lieferer des jeweiligen Gefahrgutes in dem entsprechenden Sicherheitsdatenblatt im Abschnitt 14 angeben.
Am häufigsten werden im Zusammengang mit Arbeiten der Grün- und Landschaftspflege Kraftstoffe transportiert. Um herauszufinden, ob Ihr zu transportierendes Gefahrgut auch zu Ihrem Transportbehälter passt, sollten Sie Folgendes beachten und überprüfen:
Die Gefährlichkeit von Gefahrgut drückt sich in der sogenannten Verpackungsgruppe (I, II oder III) aus. Mit der Verpackungsgruppe I wird die höchste Gefährlichkeit ausgedrückt. Die jeweiligen Angaben finden Sie im zugehörigen Sicherheitsdatenblatt.
Beispiele:
UN 1202 Diesel, 3, VG III, (E)
UN 1203 Benzin, 3, VG II, (E)
Zusätzlich müssen die Behälter nach dem gültigen Gefahrgutrecht gekennzeichnet sein. Wie die Gefahrgutbehälter beim Transport gekennzeichnet sein müssen, ergibt sich ebenfalls aus dem Sicherheitsdatenblatt.
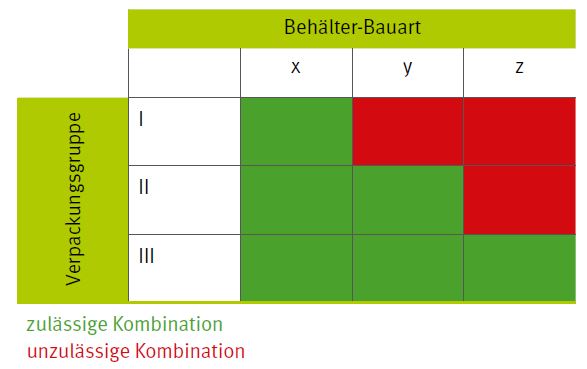
Grundsätzlich sind die Gefahrgutverpackungen folgendermaßen zu kennzeichnen:
- Mit der Kennzeichnung des Herstellers nach Gefahrstoffverordnung. Hier werden die Gefahren beim Umgang erkennbar.
- Mit Gefahrenzettel(n) nach Kapitel 5.2 ADR (auf einer Spitze stehendes Quadrat mit Symbol). Hier werden die Gefahren beim Transport erkennbar.
- Mit der UN-Nummer des Gefahrgutes (UN + vierstellige Ziffer)
- Bei umweltgefährlichen Stoffen zusätzlich mit dem dafür zutreffenden Kennzeichen (auf einer Spitze stehendes Quadrat mit dem Symbol "Fisch und Baum")
 Persönliche Schutzausrüstungen Persönliche Schutzausrüstungen
Sorgen Sie dafür, dass die erforderliche persönliche Schutzausrüstung gemäß der Angaben aus dem Sicherheitsdatenblatt des Herstellers, dem Unfallmerkblatt für das Gefahrgut bzw. gemäß Ihrer Ermittlungen aus der Gefährdungsbeurteilung zur Verfügung steht, sich in einem einwandfreien Zustand befindet und bei Notwendigkeit vollständig getragen wird. Beim Umgang mit Gefahrgütern können dies unter anderem folgende persönliche Schutzausrüstungen sein:
- Augen- oder Gesichtsschutz
- Chemikalienschutzhandschuhe
- Chemikalienschutzanzüge
- säurefeste Schürze
- Atemschutz (z. B. Atemschutzmasken)
- Fußschutz
|
3.12 Material- und Gerätetransport
In der Grün- und Landschaftspflege müssen regelmäßig die verschiedensten Materialien und Geräte zu den jeweiligen Arbeits- und Einsatzorten transportiert werden. Dies können z. B. Maschinen, Kraft- und Betriebsstoffe, Pflanzen, Handwerkzeuge oder Schüttgüter sein. Zumeist erfolgt der Transport mit Fahrzeugen. Mangelhafte oder sogar fehlende Ladungssicherung führt dabei immer wieder zu Arbeits- und Verkehrsunfällen. Auch der manuelle Transport ist mit Gefährdungen verbunden, z. B. Stürzen, Stolpern, Belastungen des Muskel-Skelett-Systems.

|
Weitere Informationen
|
- DGUV Information 214-003 "Ladungssicherung auf Fahrzeugen"
- SVLFG Broschüre B17 "Ladungssicherung im Gartenbau"
- SVLFG Broschüre B22 "Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau"
- SVLFG Broschüre B29 "Gefahrgut sicher transportieren"
- VDI 2700 "Ladungssicherung auf Straßenfahrzeugen"
|
|
Gefährdungen
|
|
Beim Material- und Gerätetransport treten häufig folgende Gefährdungen auf:
- Personen können angefahren oder überfahren werden.
- Personen können durch Fahrbewegungen gequetscht werden.
- Abgestellte Fahrzeuge, Anhänger oder mobile Arbeitsmittel können sich unbeabsichtigt in Bewegung setzen, z. B. beim Abstellen am Hang oder bei hydrostatischem Fahrantrieb.
- Mobile Arbeitsmittel können beim Be- und Entladen oder beim Transport umkippen oder vom Transportmittel abstürzen.
- Personen können auf oder von Fahrzeugen und mobilen Arbeitsmitteln stürzen.
- Transportgut kann umkippen, sich lösen und herabfallen und dadurch Personen verletzen.
- Personen können z. B. durch Bordwände getroffen werden, die durch Ladungsdruck beim Öffnen plötzlich aufschlagen.
- Die Fahrsicherheit von Fahrzeugen kann durch Überladung beeinträchtigt werden.
- Unsichere Auf- und Abstiege sowie ungeeignete Standorte auf Fahrzeugen und mobilen Arbeitsmitteln können zu Verletzungen z. B. durch Abstürzen, Umknicken, Ausrutschen führen. Dies kann insbesondere beim Be- und Entladen, Bedienen, Überwachen/Kontrollieren, Transportieren, Mitfahren der Fall sein.
- Überlastungen des Muskel-Skelett-Systems bei Handtransport.
|
|
Maßnahmen
|
|
Stellen Sie sicher, dass, abhängig von der Gefährdungsbeurteilung, gegen diese und weitere mögliche Gefährdungen folgende Maßnahmen getroffen werden:
Fahrbewegungen
Ist bei Fahr- und Arbeitsbewegungen die Sicht des Fahrzeug- oder Maschinenführers bzw. -führerin auf den Fahr- oder Arbeitsbereich eingeschränkt, z. B. durch Ladung, "tote Winkel" oder bei Rückwärtsfahrt, ist ein Einweiser bzw. eine Einweiserin oder Sicherungsposten einzusetzen. Einweiser und Einweiserinnen dürfen sich nur im Sichtbereich des Fahrzeug- oder Maschinenführers bzw. -führerin befinden. Sie dürfen sich nicht zwischen dem Fahrzeug und in dessen Bewegungsrichtung befindlichen Hindernissen aufhalten.
Es gibt technische Lösungen mit denen die Sicherheit beim Rückwärtsfahren erhöht werden kann, z. B. Heck- und Arbeitsbereichskameras, Ultraschall- oder Radarwarnanlagen eventuell mit geeigneten Fahrerassistenzsystemen. Sie erhöhen bereits heute die Sicherheit in Fahrzeugen. Die Aufgaben dieser Systeme reichen von der Warnung der Fahrer und Fahrerinnen bis hin zu selbstständigem Stoppen des Fahrzeugs. Aber ein vollwertiger Ersatz für eine einweisende Person sind sie noch nicht.

Abb. 147 Baumtransport mit Kamera-Monitor-System
Be- und Entladen
Fahrzeuge dürfen weder überladen noch so be- oder entladen werden, dass Personen gefährdet werden.
- Für den Transport ist die Ladung gegen Gefahr bringende Lageveränderung zu sichern. Möglichkeiten zur Ladungssicherung sind z. B.
- Zurrgurte, Zurrketten, Netze und Planen
- Antirutschmatten
- Spannbretter/Sperrstangen
- Stirnwandgestell
Siehe Kapitel 3.13 Ladungssicherung
- Beim Öffnen von Bordwandverschlüssen und beim
Abkippen ist der Aufenthalt im Schüttbereich und
im Bereich ausschwingender Ladeklappen von Fahrzeugen
unzulässig.
- Wird Material, z. B. mit einem Bagger verladen und dabei
über die Fahrzeugkabine geschwenkt, hat der Fahrer
oder die Fahrerin zuvor die Kabine zu verlassen, sofern
kein spezielles Schutzdach gegen herabfallende Gegenstände
vorhanden ist.
- Das zulässige Gesamtgewicht des Fahrzeugs, insbesondere
bei der Beladung mit Schüttgütern wie Splitt, Kies,
feuchter Mutterboden, darf nicht überschritten werden.

|

|

|
Abb. 149 absenkbare Ladeflächen |
Abb. 150 LKW mit Ladekran |
Abb. 151 Hubladebühne |
Abstellen und Abhängen
Bei automatischen Kupplungssystemen beim Ankuppeln nicht zwischen Fahrzeug und Anhänger treten.
Vor dem Verlassen von Fahrzeugen ist
- der Motor abzustellen,
- die Feststellbremse zu betätigen,
- der kleinste Gang einzulegen (am Hang gegenläufig).
Beim Abstellen von Fahrzeugen am Hang sowie grundsätzlich beim Abstellen von Anhängern sind die notwendigen Unterlegkeile zu verwenden. Beim Abstellen mobiler Arbeitsmittel sind unbedingt die Hinweise des Herstellers in der Bedienungsanleitung zu beachten, z. B. die Besonderheiten bei hydrostatischem Fahrantrieb.
Handtransport
Beim Heben und Tragen von Lasten auf die ergonomisch richtige Körperhaltung achten.
Schwere und unhandliche Lasten, wie z. B. Kübelpflanzen, wenn möglich mit Hilfsmitteln transportieren.
Geeignete Hilfsmittel können z. B. sein:
- Sackkarren, Hubwagen, Rollvorrichtungen
- Schubkarren
- Hebegurte
- spezielle Greif- oder Packzangen
Sorgen Sie dafür, dass die von Ihnen bereitgestellten Hilfsmittel benutzt werden.

|

|

|
Abb. 152 Mini-Dumper/Motorschubkarre für
ergonomischen Materialtransport im Gelände |
Abb. 153 Kübeltransport mit Hilfsmittel |
Abb. 154 spezielle Greif- oder Packzange für den
ergonomischen Transport von Stammabschnitten |
|
3.13 Ladungssicherung
Mängel bei der Ladungssicherung können selbst beim Einsatz geeigneter Fahrzeuge durch Vollbremsungen, Ausweichmanöver, zu hoher Geschwindigkeit in Kurven, schnellem Anfahren an Steigungen oder Fahrbahnunebenheiten zu schweren Unfällen führen. Der Einsatz geeigneter Hilfsmittel zur Ladungssicherung und fundierte Kenntnisse der Beschäftigten in Bezug auf Ladungssicherung verhindern solche Unfälle. Für die ordnungsgemäße Sicherung der Ladung sind Halter oder Halterin, Fahrer oder Fahrerin und ggf. Verlader oder Verladerin verantwortlich.

|
Rechtliche Grundlagen
|
- §§ 22, 23 Straßenverkehrs-Ordnung (StVO)
- § 31 Abs. 2 Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO)
- DGUV Vorschrift 70 und 71 "Fahrzeuge"
|
|
Weitere Informationen
|
- SVLFG Broschüre B17 "Ladungssicherung im Gartenbau"
- "Ladungssicherung auf Fahrzeugen der Bauwirtschaft", Ausgabe: 2016, Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft, Berlin
- VDI Richtlinie 2700 "Ladungssicherung auf Straßenfahrzeugen"
- CD "Ladung sichern"; Herausgeber: Deutscher Verkehrssicherheitsrat und die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung in besonderer Zusammenarbeit mit der Berufsgenossenschaft Verkehrswirtschaft Post-Logistik Telekommunikation (BG Verkehr)
|
|
Gefährdungen
|
|
Gefährdungen können im Fahrbetrieb, einschließlich Ausweichmanövern und Vollbremsungen, entstehen für Fahrer oder Fahrerin, Mitfahrende und andere Verkehrsteilnehmer unter anderem durch
- negative Beeinflussung der Fahreigenschaften von Fahrzeugen und Anhängern,
- unkontrolliert verrutschende, umkippende, wegfliegende oder herabfallende Ladung.
Häufige Ursachen dafür sind:
- Überschreiten des zulässigen Gesamtgewichts,
- Über- oder Unterschreiten der zulässigen Achslasten und Stützlasten,
- einseitiger Ladungsschwerpunkt,
- zu hoher Ladungsschwerpunkt,
- nicht oder unzureichend gesicherte Ladung.
Gefährdungen bei der Durchführung der Maßnahmen zur Ladungssicherung können z. B. dadurch entstehen, dass Personen durch sich schlagartig lösende Einrichtungen (z. B. Spanngurte, Spannketten, Zurrpunkte) oder durch die Ladung selbst getroffen werden. Ursachen hierfür können z. B. sein:
- Versagen von mangelhaften Zurrmitteln,
- Überlastung von Zurrmitteln oder Zurrpunkten,
- Verwendung ungeeigneter Zurrpunkte (am Fahrzeugaufbau oder an der Ladung).
- Nicht bestimmungsgemäße Verwendung von Zurrmitteln oder Zurrpunkten aufgrund unzureichender Fachkenntnisse
Zu Gefährdungen beim Be- und Entladen siehe Kapitel 3.12.
|
|
Maßnahmen
|
|
Stellen Sie sicher, dass, abhängig von der Gefährdungsbeurteilung, gegen diese und weitere mögliche Gefährdungen folgende Maßnahmen getroffen werden:
Grundsätzliches
Es werden für die jeweilige Transportaufgabe geeignete Fahrzeuge zur Verfügung gestellt.
- Es stehen geeignete Mittel zur Ladungssicherung in ausreichender Anzahl zur Verfügung.
- Fahrer oder Fahrerin und Verlader oder Verladerin verfügen über fundierte Kenntnisse zur Ladungssicherung.
Gewichte
Die Fahrer und Fahrerinnen kennen das zulässige Gesamtgewicht des Fahrzeugs, die zulässigen Achslasten und die maximale Stützlast der Anhängerkupplung.
- Die Gewichte der regelmäßig zu transportierenden Maschinen, Geräte, Arbeitsstoffe und Materialen sind bekannt.
- Zur Einschätzung von unbekannten Ladungsgewichten, z. B. Stammabschnitte nach Baumfällarbeiten, werden im Fahrzeug gegebenenfalls Tabellen mitgeführt.
Lastverteilung und Ladungsschwerpunkt
Der Lastverteilungsplan ist bekannt und wird berücksichtigt. Er gibt an, wie die Ladung (Gewicht und Schwerpunktlage) auf dem Fahrzeug zu verteilen ist, damit:
- die zulässige Gesamtmasse nicht überschritten wird,
- die zulässigen Achslasten nicht über- oder unterschritten werden und
- der Schwerpunkt unterhalb der Lastverteilungskurve liegt.
Der Lastverteilungsplan gehört zum Fahrzeug und sollte beim Fahrzeugkauf bzw. vom Fahrzeughersteller oder Aufbauhersteller mitgeliefert bzw. angefordert werden.
Das Fahrzeug wird so beladen, dass der Ladungsschwerpunkt möglichst auf der Längsmittellinie des Fahrzeugs liegt und so niedrig wie möglich gehalten wird.
Durchführung der Ladungssicherung
Stellen Sie sicher, dass die Ladung so verstaut oder gesichert wird, dass sie unter üblichen Verkehrsbedingungen (einschließlich Ausweichmanövern und Vollbremsungen) nicht verrutschen, verrollen, umfallen, herabfallen oder kippen kann.
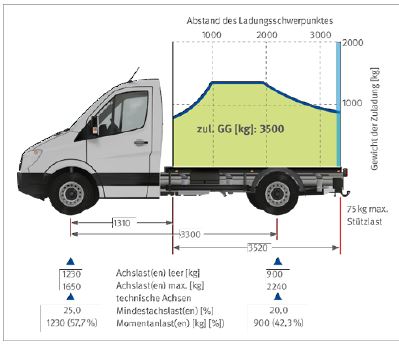
Abb. 156 Lastverteilungsplan
Bei der Auswahl der Sicherungsmaßnahmen sind die formschlüssigen Verfahren dem kraftschlüssigen Niederzurren vorzuziehen.
Formschlüssige Verfahren sind z. B. das Direktzurren (Diagonal-, Schräg- bzw. Horizontalzurren, Umreifungszurren und Kopfschlingenzurren) und das Festsetzen an der Stirnwand oder Verkeilen.
Beim Direktzurren wird das Ladegut mit Hilfe von zugelassenen Zurrketten oder Zurrgurten an den Zurrpunkten gesichert. Die verwendeten Transportfahrzeuge und Anhänger verfügen über eine ausreichende Zahl von Zurrpunkten an denen Ladungen festgezurrt werden können. Die maximale Belastbarkeit der Zurrpunkte ist gekennzeichnet und wird beachtet.
Eine weitere Möglichkeit der formschlüssigen Ladungssicherung ist das Festsetzen der Ladung durch Sperrstangen oder Klemmbretter.

|

|

|
Abb. 157 Sicherung durch Direktzurren |
Abb. 158 Zurrpunkt an einer Maschine |
Abb. 159 Kennzeichnung eines Zurrpunktes |
Beste Praxis
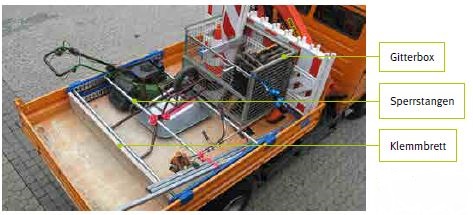
Abb. 160 Formschluss durch Trennbretter und Sperrbalken

|

|
Abb. 161 Formschlüssige Ladungssicherung eines Tankes |
Abb. 162 Sicherung einer Flüssiggasflasche mit Umreifungsgurt und Bordwandkrallen |

|

|
Abb. 163 Formschlüssige Sicherung von Besen und Schaufel an einer Pritschenstirnwand |
Abb. 164 Sicherung von Kraftstoffbehältnissen durch Formschluss |
|
Kraftschlüssiges Verfahren
Zu den kraftschlüssigen Verfahren zählt das Niederzurren. Die Sicherung der Ladung wird hier über das Anpressen des Ladeguts auf die Ladefläche mittels Spanngurten (Erhöhung der Reibungskraft) erreicht.
Prüfen Sie den Einsatz von Kantenschonern, da diese nicht nur Ihr Ladegut schonen, sondern auch die Vorspannkraft verteilen. Antirutschmatten erhöhen deutlich die Reibung zwischen Ladegut und Ladefläche und sollten daher insbesondere beim Niederzurren stets eingesetzt werden.
Vor dem Beladen wird die Ladefläche gereinigt, z. B. durch Fegen.
Bei sehr hohen Ladungsmassen stößt das Verfahren aber aufgrund der hohen Anzahl an erforderlichen Zurrmitteln an seine Grenzen. Daher haben sich Kombinationen aus formschlüssigen und kraftschlüssigen Verfahren bewährt.
Abdecknetze oder Planen
Abdecknetze oder Planen dienen lediglich zum Sichern von leichtem Ast- und Strauchwerk, Mähgut, Laub und dergleichen gegen Wegfliegen. Sie dürfen nicht verwechselt werden mit Ladungssicherungsnetzen.

Abb. 165 Abdecknetz
Sicherungssystem/Sicherungsnetz
Nicht alle Ladegüter, vor allem viele unterschiedliche bzw. wechselnde in Zusammenladung, lassen sich alleine mit Zurrgurten sachgerecht sichern. Hierfür können Ladungssicherungsnetze (auch Zurrnetze genannt) als geeignete Hilfsmittel in Frage kommen. Durch den modularen und flexiblen Aufbau solcher Sicherungsnetze kann ein wechselnder Einsatz im vorderen, mittleren oder hinteren Bereich des Fahrzeugs ermöglicht werden. Auch eine Anpassung an unterschiedliche Ladehöhen ist damit möglich. Darüber hinaus können Ladungssicherungsnetze zur Bildung von Ladeeinheiten und zur Sicherung von Stückgewichten entsprechend der Nutzlast bzw. der Zurrpunktbelastbarkeit geeignet sein.
Bisher bietet der Markt jedoch kaum "Konfektionslösungen". Interessierte müssen sich einen namhaften Zurrmittel-Hersteller suchen, der ihnen bei der Problemlösung behilflich ist.

Abb. 166 Ladungssicherungsnetz
Fahrweise
Stellen Sie sicher, dass Ihre Beschäftigten die Fahrgeschwindigkeit je nach Ladegut auf Straßen-, Verkehrs- und Witterungsverhältnisse sowie auf die jeweiligen Fahreigenschaften des Fahrzeugs abstimmen.
Prüfungen
Zurrmittel unterliegen einem sehr hohen Verschleiß. Sorgen Sie deshalb dafür, dass diese vor jeder Benutzung einer Sichtkontrolle auf augenscheinliche Mängel durch Fahrer bzw. Fahrerinnen oder Verladerinnen bzw. Verlader unterzogen werden. Unabhängig davon sind Zurrmittel regelmäßig durch eine befähigte Person prüfen zu lassen. Bewährt hat sich eine Prüfung mindestens einmal jährlich.
 Qualifizierung für die Ladungssicherung Qualifizierung für die Ladungssicherung
Maßnahmen der Ladungssicherung können sehr komplex sein. Sorgen Sie deshalb dafür, dass Fahrer oder Fahrerinnen bzw. Lader oder Laderinnen über fundierte Kenntnisse zur Ladungssicherung verfügen, z. B. durch geeignete Schulungen. Der Stand der Technik in der Ladungssicherung wird durch die Richtlinienreihe VDI 2700 "Ladungssicherung auf Straßenfahrzeugen" beschrieben.
|